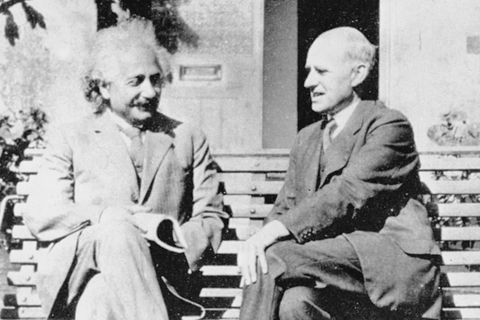Sonnenfinsternisse sind ebenso seltene wie spektakuläre Naturphänomene – die im ganzen Sonnensystem nur auf der Erde zu beobachten sind. Mindestens zweimal pro Jahr schiebt sich der Mond so zwischen Sonne und Erde, dass er einen kreisrunden Schatten auf die Erdoberfläche wirft – wenn auch nur in einem Gebiet mit einem Durchmesser von wenigen hundert Kilometern. Neben der plötzlichen Verdunkelung am hellichten Tag hat die ungewöhnliche Konstellation der Himmelskörper Auswirkungen auf das Leben auf der Erde: Pflanzen stellen sich auf die Nacht ein und schließen ihre Blüten, Tiere begeben sich zur Nachtruhe.
Nun macht ein niederländisches Forscherteam auf einen verblüffenden, aber bislang wenig untersuchten Effekt einer totalen Sonnenfinsternis aufmerksam: Wolken in den tiefen Schichten der Atmosphäre, darunter Cumuluswolken, lösen sich während der Verdunkelung auf.
Wie die Forschenden um Viktor Trees von der niederländischen TU Delft und dem Königlich-Niederländischen Meteorologischen Institut im Fachmagazin Nature Communications Earth and Environment berichten, beginnen die etwa zwei Kilometer hohen Cumuluswolken, auch Haufenwolken genannt, schon bei einer Verdunkelung von nur 15 Prozent zu schwinden. Während der maximalen Verdunkelung verringert sich die Wolkendecke um rund 30 Prozent – und beginnt schon 50 Minuten danach wieder, sich zu "erholen".
Der Mondschatten lässt den Erdboden erkalten
Die Forschenden stützten sich bei ihren Untersuchungen auf die Daten von zwei Wettersatelliten. Während dreier totaler Sonnenfinsternisse über Afrika dokumentierten die künstlichen Erdtrabanten auf geostationären Umlaufbahnen, also ohne ihre Position relativ zur Erdoberfläche zu verändern, im Bereich des sichtbaren und des infraroten Lichts die Wolkenbedeckung.
Der Grund für das "künstliche" Wetterphänomen: Im Schatten des Mondes beginnt sich der Erdboden sofort abzukühlen. In der Folge steigt kühlere Luft auf, die weniger Wasserdampf enthält; der Wassernachschub für die Wolken versiegt. Erwärmt sich der Boden gegen Ende der Sonnenfinsternis wieder, bilden sich innerhalb kürzester Zeit neue Wolken. Den Effekt konnte das Team auch mithilfe eines Computermodells bestätigen. Über dem Meer dagegen zeigt sich das Phänomen nicht. Denn das Ozeanwasser braucht länger als Sand und Fels, um sich abzukühlen.
Geoengineering könnte weniger effektiv sein als gedacht
Die neuen Erkenntnisse werfen die Frage auf, wie wirksam Verfahren sind, die Erde künstlich herunterzukühlen. Das so genannte Geoengineering – auch Climate Engineering genannt – zielt darauf ab, beispielsweise durch Sonnensegel im All oder künstlich angeregte Wolkenbildung die Sonneneinstrahlung auf der Erde zu verringern, um den Klimawandel zu bremsen.
"Wenn wir die Sonne in Zukunft mit technischen Lösungen verdunkeln, könnte sich das auf die Wolken auswirken", warnt Viktor Trees in einer Presseerklärung der TU Delft. "Weniger Wolken könnten dem beabsichtigten Effekt des Climate Engineering zum Teil entgegenwirken, denn Wolken reflektieren das Sonnenlicht und tragen so eigentlich zur Abkühlung der Erde bei."
Die nächste totale Sonnenfinsternis wird in Nordamerika schon am 8. April 2024 zu bestaunen sein, in Europa dagegen erst 2026 in Spanien. Von Deutschland aus wird die nächste totale Verdunkelung sogar erst im September 2081 zu sehen sein – und nur im Gebiet um den Bodensee. Die Norddeutschen müssen sich sogar noch länger gedulden: Hier wird die nächste Sonnenfinsternis erst im Oktober 2135 zu bestaunen sein.