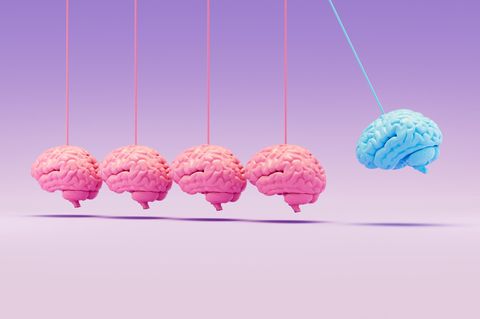Ein Adler ritzt Jon Snow eine Narbe ins Gesicht, Cersei Lannisters lange Wellen werden zum Kurzhaarschnitt geschoren und die anfangs 11-jährige Arya Stark wächst vor den Augen der Zuschauenden auf. Die Charaktere der TV-Serie "Game of Thrones" verändern sich über die acht Staffeln hinweg enorm – optisch wie charakterlich. Das machten sich Forschende der University of York zunutze, um zu ergründen, wie wir die Gesichter anderer Menschen wiedererkennen. Und fanden heraus, warum es einigen einfach nicht gelingen will.
Eine von 50 Personen ist gesichtsblind
Die meisten Menschen erkennen ihre beste Freundin oder die Chefin ohne nachzudenken. Bei jeder fünfzigsten Person ist das anders: Sie sind von Prosopagnosie betroffen, der Gesichtsblindheit. Dabei handelt es sich um eine neurologische Störung, die entweder angeboren ist oder durch eine Kopfverletzung entsteht. Betroffene können die Welt um sich herum zwar sehen, doch die Gesichter anderer Menschen bleiben ihnen fremd. Selbst die vertrautesten Gesichter – sogar ihr eigenes Spiegelbild – erkennen sie je nach Ausprägung nicht.
Fachkundige unterscheiden zwischen zwei Hauptformen der Krankheit: Menschen mit apperzeptiver Gesichtsblindheit haben Schwierigkeiten dabei, visuelle Informationen aus Gesichtern richtig zu verarbeiten. Sie schaffen es nicht, Alter oder Geschlecht zu bestimmen, ein Gesicht sieht aus wie das andere. Menschen mit assoziativer Gesichtsblindheit hingegen können solche Merkmale durchaus wahrnehmen. Sie können aber nicht sagen, ob es sich um eine fremde oder vertraute Person handelt. Das kann zu psychischen und sozialen Problem führen: Die Chefin nimmt es übel, wenn sie am Bahnhof ignoriert wird, die beste Freundin ist gekränkt, wenn sie in fragende Augen blickt. Eine spezifische Therapie gibt es bis heute nicht.
Um Gesichtsblindheit und die dahinterliegenden Mechanismen der Gesichtserkennung besser zu verstehen, beschritt das Team um Psychologin Kira Noad einen neuen Weg. "Unser Ziel war es, ein Studienformat zu schaffen, das dem wirklichen Leben ähnlicher ist", so Mitautor und Professor Timothy Andrews. Meist würden für solche Untersuchungen Fotos von Promis oder Fremden genutzt. Für ihre Studie, die in "Cerebral Cortex" erschien, wählten sie stattdessen Videos. So sollten komplexere Szenen und mehrere Personen auf einmal gezeigt werden.
"Wir haben uns dafür entschieden, den Teilnehmenden Filmmaterial aus Game of Thrones zu zeigen, weil die Serie Menschen auf der ganzen Welt mit ihren starken Charakteren und tiefgründigen Persönlichkeiten fesselt", so Studenleiterin Noad.
Nicht nur Nase oder Augen sind entscheidend
70 Personen nahmen an der Studie teil und waren dabei in zwei Gruppen eingeteilt: Eine Hälfte kannte die Serie bereits, die andere hatte sie nie gesehen. Während sie Szenen der Serie schauten, wurde ihre Gehirnaktivität mithilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) gemessen. Damit lassen sich Veränderungen im Blutfluss erfassen. Aktive Gehirnregionen benötigen mehr Sauerstoff, werden daher stärker durchblutet und leuchten dann im fMRT auf.
Bei den Teilnehmenden, die mit Charakteren wie Jon Snow oder Daenerys Targaryen vertraut waren, leuchteten beim Zuschauen mehrere Hirnregionen: Solche für visuelle Wahrnehmung und solche, die Wissen und Emotionen zu einer Person speichern. Auch die Verbindungen zwischen diesen Regionen war bei ihnen deutlich aktiver als bei der anderen Hälfte der Stichprobe. Das weckte bei den Forschenden einen Verdacht: Hängt unsere Fähigkeit Gesichter zu erkennen von der Verknüpfung zwischen visuellen Informationen und dem Wissen über eine Person ab? Also führte das Team die Studie erneut durch – diesmal mit gesichtsblinden Menschen.
Obwohl auch hier die Hälfte der Teilnehmenden die Serie kannte, zeigte sich bei beiden Gruppen eine geringe Gehirnaktivität in den relevanten Bereichen. Und vor allem: Die Verbindungen zwischen visuellen und wissensbezogenen Regionen waren deutlich reduziert. Die Teilnehmenden hatten offenbar Probleme damit, das Gesicht mit ihrem gespeicherten Wissen über die Person zu verknüpfen.
Nicht nur Nase oder Augen sind entscheidend
Bisher sei man davon ausgegangen, dass wir Gesichter über ihre visuellen Eigenschaften erkennen, sagt dazu Andrews. Doch anhand dieser Untersuchung zeigt sich: Wir erkennen Gesichter nicht nur anhand einer markanten Nase oder strahlend blauen Augen – sondern auch und in Verbindung damit, was wir über die Person wissen, zum Beispiel über ihre Charaktereigenschaften, ihre Körpersprache oder unseren Gefühlen ihr gegenüber.
"Wir müssen weitere Studien durchführen, um genauer zu untersuchen, wie die Aktivität in den verschiedenen Hirnregionen es uns ermöglicht, Gesichter zu erkennen", so Noad, "und welche Faktoren diesen Prozess stören können." So könnten langfristig Therapien für gesichtsblinde Menschen entwickelt werden.