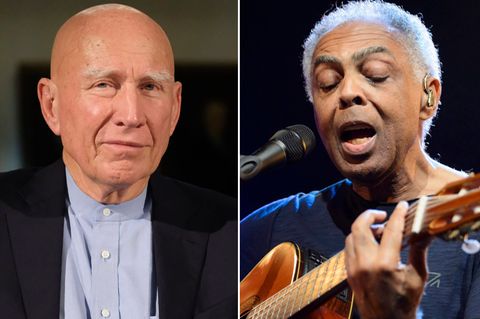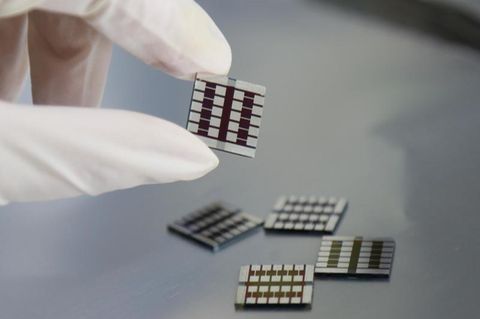Aluminium-Chloride: Krebserregende Salze
In Kosmetikprodukten werden Aluminiumsalze (Aluminium Chloride) vor allem als Antitranspirant-Wirkstoffe verwendet. Besonders häufig finden sich die Aluminiumsalze in Deodorants und verschließen so die Poren und hemmen die Schweißbildung. Doch nicht nur in Deodorants, auch in Zahnpasta und in Lippenstiften finden sich besonders häufig die gefährlichen Aluminiumverbindungen.
Aluminium wird immer wieder mit der Entwicklung von Alzheimer und der Entstehung von Brustkrebs in Verbindung gebracht, gilt als nervenschädigend und hautirritierend. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hält eine Aufnahmemenge von 1 Milligramm Aluminium je Kilogramm Körpergewicht pro Woche für tolerierbar. Das entspricht einer täglichen Dosis von etwa 8,6 Mikrogramm pro Tag bei einen 60 Kilogramm schweren Erwachsenen.
Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat die geschätzte Aluminiumaufnahme aus Antitranspirantien bewertet. In den Ergebnissen wird das Ausmaß der Aluminiumchloride in der Kosmetik deutlich: Bereits bei einmaliger täglicher Anwendung aluminiumhaltiger Antitranspirantien liegen die Aluminiumwerte über der wöchentlich tolerierbaren Aufnahmemenge der EFSA.
Eine Gute Nachricht gibt es aber doch: Auf der Verpackung können Sie Aluminium leicht erkennen! Es wird als "Aluminum Silicate" oder "Aluminum Chlorohydrate" gekennzeichnet. Zudem hat Ökotest 21 aluminiumfreie Deos getestet und den Testbericht auf seiner Webseite veröffentlicht.
Mikroplastik (Polyethylene): Unsichtbare Gefahr
Einige Kosmetikhersteller setzen kleine Plastikteilchen, sogenanntes Mikroplastik, in Kosmetikprodukten wie Peelings, Cremes oder Shampoos und Haarsprays ein. Meist versteckt sich der Kunststoff hinter Bezeichnungen wie Polyethylen, Nylon-6 oder Polyacrylat (siehe hierzu Tabelle unten).
In fester und flüssiger Form werden die Plastikteilchen als Schleifmittel in Hautpeelings, als Filmbildner in Sonnencremes oder schlicht als günstiges Bindemittel in Cremes eingesetzt. Über die Kosmetik gelangt das Mikroplastik ins Abwasser und landet später in den Kläranlagen, die die Plastikpartikel jedoch nicht gänzlich aus dem Wasser filtern können. So gelangt das Mikroplastik schließlich in die Umwelt und findet sich in Fischen, Flusskrebsen oder Muscheln wieder.
Für Verbraucher ist es fast unmöglich herauszufinden, ob und in welcher Form Mikroplastik im Kosmetikprodukt enthalten ist, da es keine Kennzeichnungen gibt. Der BUND spricht sich daher gegen die Verwendung von Mikroplastik und anderen Kunststoffformen in Kosmetikartikeln aus.
Die häufigsten Kunststoffe in Kosmetika:
Kunststoff | Abkürzung |
Polyethylen | PE |
Polypropylen | PP |
Polyethylenterephthalat | PET |
Nylon-12 | Nylon-12 |
Nylon-6 | Nylon-6 |
Polyurethan | PUR |
Acrylates Copolymer | AC |
Acrylates Crosspolymer | ACS |
Polyacrylat | PA |
Polymethylmethacrylat | PMMA |
Polystyren | PS |
- Tipp: Der Einkaufsratgeber "Mikroplastik – die unsichtbare Gefahr" des BUND gibt Ihnen Auskunft darüber, in welchen Kosmetikprodukten sich Mikroplastik versteckt. Der Ratgeber wird regelmäßig aktualisiert.
- Checkliste: GREENPEACE listet gängige Kunststoffe in Kosmetik- und Körperpflegeprodukten in seiner Checkliste "Plastik abschminken". Damit erkennen Sie leicht, ob sich in Ihren Kosmetikprodukten Mikroplastik befindet.
Duftstoffe: Gut riechende Allergene
Klar, jeder duftet gern - das weiß auch die Kosmetikindustrie. Deshalb enthalten fast alle Kosmetikartikel wie Duschgels oder Shampoo diverse Duftstoffe. Meist ganz harmlos als "Parfum" oder "Aroma" deklariert, enthalten nicht wenige allergene Zusatzstoffe wie beispielsweise gefährliche Moschusverbindungen (Civet/Zibet). Diese sind in der Umwelt nur schwer abbaubar und reichern sich im Körper an.
Duftstoffe aus Moschus oder Ambra sind zudem tierischer Herkunft und können auch Allergien auslösen. Bei Tierversuchen wurden zudem krebserregende und erbgutverändernde Eigenschaften festgestellt.
Der Deutsche Allergie- und Asthmabund e.V. (DAAB) hat basierend auf Forschungsergebnissen des Wissenschaftlichen Beratungskomitees der Europäischen Union (SCCNFP) 26 natürliche und synthetische Duftstoffe identifiziert, von denen sieben Stoffe als potente Allergene gelten, die also allergische Reaktionen wie Juckreiz oder Schwellungen hervorrufen können. Dazu gehören unter anderem Citral, Farnesol und Linalool.
Bei einigen Duftstoffen wird davon ausgegangen, dass sie auch über die Haut aufgenommen werden können und so im ganzen Körper verteilt werden. Eine andere für das Umweltbundesamt durchgeführte Studie ergab, dass es mindestens eine halbe Million Duftstoff-Allergiker in Deutschland gibt.
Die allergenen Duftstoffe müssen nach der Europäischen Kosmetikverordnung auf den Kosmetika angegeben werden, falls sie die festgelegte Konzentrationen überschreiten. Oft bleiben die Kosmetikhersteller jedoch unter der deklarationspflichtigen Grenze oder ersetzen diese Substanzen durch andere Duftstoffe, die sie nicht extra angeben müssen, die aber möglicherweise Allergien auslösen.
Nanopartikel: Unerforschte Gefahr
In Kosmetika wie Zahnpasta, Lippenstift oder Sonnencreme werden sogenannte Nanopartikel eingesetzt, winzige Teilchen, die über tausend Mal dünner sind als der Durchmesser eines Menschenhaares. Die Pigmente Titanoxid und Zinkoxid etwa werden in der Sonnenmilchproduktion eingesetzt und legen sich wie ein Film auf die Haut, um Sonnenlicht zu reflektieren.
Das klingt alles erstmal positiv, doch die Nanopartikel in Kosmetika sind umstritten. Ihre Wirkung auf Mensch und Umwelt ist bislang noch nicht ausreichend erforscht, viele aussagekräftige Studien gibt es bisher nicht. Völlig unklar ist, wie sich winzige Nanopartikel, in Kosmetikprodukten eingesetzt, auf unsere Gesundheit auswirken.

Studien des Umweltbundesamtes zu Nanopartikeln weisen zudem auf eine möglicherweise krebsauslösende Wirkung einiger Nanomaterialien wie Kohlenstoff-Nanoröhren (CNTs) oder Titandioxid (TiO2) hin, die durchaus ernst zu nehmen sind.
Bislang müssen Herstellerinnen und Hersteller Produkte, die Nanopartikel enthalten, nicht kennzeichnen. Verbraucher erfahren also nicht, welche Kosmetika die winzigen Nanopartikel enthalten. Deshalb setzt sich der BUND für einen Einsatzstopp von synthetischen Nanopartikeln ein, bis ihre Wirkung auf Mensch und Umwelt geklärt ist.
Paraffine: Kosmetik aus Erdöl
Seit Jahrzehnten werden Paraffine in herkömmlichen Pflegeprodukten wie Cremes oder Lotionen als Konsistenzgeber verwendet. In der Kosmetik werden sie wegen ihrer filmbildenden und wasserabweisenden Eigenschaften genutzt, außerdem fördern Paraffine die Glanzbildung auf der Haut, was sie zu beliebten Inhaltsstoffen in Lippenstiften macht. Weiterhin schützen sie die Haut vor Feuchtigkeitsverlust.
Paraffine sind Kohlenwasserstoffe, die aus Erdöl gewonnen werden. Die Erdölförderung ist jedoch nicht nur umweltschädlich, sondern der Stoff ist auch giftig.
So fand Stiftung Warentest im Jahr 2015 krebserregende Substanzen in Kosmetikprodukten mit Mineralöl. Die am häufigsten eingesetzten Kohlenwasserstoffe innerhalb der Kosmetik sind Paraffinöl (Paraffinum Liquidum) und Vaseline (Petrolatum).
Tenside: Zugang für Schadstoffe
Von Badezusätzen über Haarfestiger und Shampoos bis hin zu Zahnpasta und Mundsprays sind Tenside überall zu finden. Tenside sind waschaktive Substanzen, die beim Einsatz in der Kosmetik auch als Emulgatoren bezeichnet werden. In Shampoos finden Tenside beispielsweise Verwendung, um die Löslichkeit von Fett- und Schmutzpartikel, die am Körper haften, in Wasser zu erhöhen.
In der Kosmetikindustrie verwendete Tenside sind beispielsweise lineare Alkylbenzolsulfonate, Alkylpolyglycoside, Esterquats und Fettalkoholethoxylate. Konventionelle Kosmetikprodukte verwenden zudem oft die Tenside Sodium-Lauryl-Sulfat und PEG-Derivate, um noch stärker zu schäumen. Deren Waschkraft wird dann jedoch so stark, dass sie mehr Talg auf der Haut entfernen als gesund ist.
Dies hat einen Auswaschungseffekt zur Folge: Die Haut verliert ihre natürliche Schutzfunktion und wird durchlässiger für Schadstoffe. Damit sind tensidehaltige Kosmetikprodukte unter Umständen allergieauslösend. Außerdem werden PEG-Derivate häufig aus krebserregenden Erdöl-Derivaten hergestellt.
Lichtschutzfilter: Hormonbomben auf der Haut
Viele Kosmetika wie Sonnenmilch, Gesichtscremes und Lippenbalsam enthalten UV-Filter, um uns vor der Sonnenstrahlung zu schützen und dem Hautkrebsrisiko vorzubeugen.
Leider haben synthetische UV-Filter auch ihre Schattenseiten, zum Beispiel die gesundsschädlichen Stoffe Bezophenone. Diese Inhaltsstoffe sind hormonell wirksam, irritierend für Haut und Augen, allergieauslösend und stehen in Verdacht, krebserregend zu sein. In schlimmsten Fällen kann es gar zu Nervenschädigungen und Veränderung der Erbanlagen führen.
Benzophenone verhindern zwar erfolgreich Sonnenbrand, aber bleiben leider nicht ohne Nebenwirkungen. Chemische Lichtschutzfilter bleiben nicht auf der Hautoberfläche, sondern dringen in den Körper ein. Die Folge sind Fruchtbarkeitsstörungen, Fettleibigkeit oder Geschwüre an Leber und Nieren. Bereits im Jahr 1998 hatte Öko-Test zum ersten Mal Rückstände von synthetischen Lichtschutzfiltern in der Muttermilch nachgewiesen.
Beim Kontakt mit der Haut können zudem neue Molekülverbindungen entstehen, die Allergien hervorrufen und die Enzyme der Haut angreifen. Bereits im Jahr 2001 hat das Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Universität Zürich eine Untersuchung vorgelegt, aus der hervorging, dass synthetische Lichtschutzfilter ähnlich wie das weibliche Hormon Östrogen wirken können.
Diese Substanzen in der Liste der Inhaltsstoffe der Kosmetik zu finden, erfordert genaues Lesen: Ihre Bezeichnungen sind teilweise lang und kompliziert. Wir haben Ihnen die häufigsten synthetischen UV-Filter in einer Tabelle zusammengestellt.
Lichtschutzfilter mit hormonaktiven Wirkungen:
Filtersubstanz | Abkürzung |
Benzophenone-3 | Bp-3 |
Benzophenone-2 | Bp-2 |
Benzophenone-1 | Bp-1 |
4-Methylbenzyliden camphor | 4-MBC |
3-Benzylidencamphor | 3BC |
Homosalate | HMS |
Butylmethoxydibenzoylmethan | BMDEM |
Ethylhexylmethoxycinnamat | EHMC |
Octyldimethyl PABA | OD – PABA |
Wer also beim Sonnenschutz ganz sicher gehen will, setzt auf Naturkosmetik, trägt entsprechenden Sonnenschutz und setzt sich nicht unnötig lange der starken Sonnenstrahlung aus.