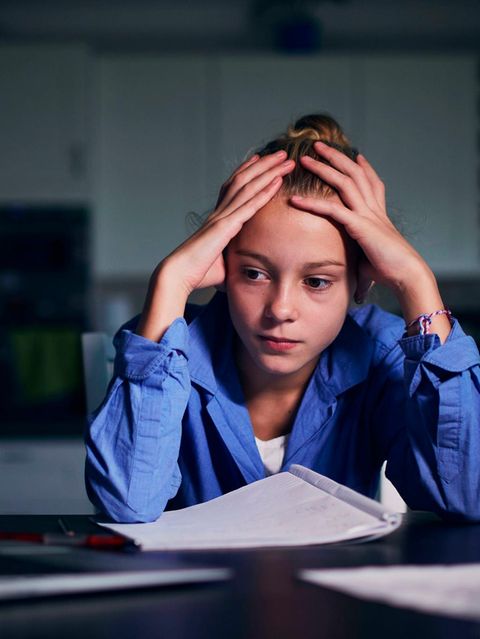Es ist zauberhaft, eine Sache zum ersten Mal zu machen. Diesen Sommer war das so, bei meiner ersten Hochtour über Gletschereis. Abenteuerlich war es und erfüllend. Aber in jeden Stapf der Steigeisen mischte sich ein wenig Wehmut: Meine Kinder werden das nicht erleben können. Denn in spätestens zehn Jahren, so prognostizieren es Forschende, sollen alle deutschen Gletscher verschwunden sein. Die restlichen der Alpen werden bald darauf folgen.
Überall in den Bergen starren mich ihre kläglichen Überreste an. Wie ein verängstigtes Kind kauert sich der Blaueisgletscher am Hochkalter ins hinterste Ende des Tals, wie eine Lache aus verschütteter Milch scheint der Schneeferner auf der Zugspitze in den kiesigen Untergrund zu versickern.

Ich bin zu jung, um die Gletscher anders gekannt zu haben. Aber auf vergilbten Fotos in den Berghütten hängen oft Bilder aus ihren guten Jahren, massig und prächtig, ganze Täler füllend. Neben den Pfaden zeugen glattgeschmirgelte Steinbrocken und meterhohe Moränen von ihrer einstmals gewaltigen Kraft. Es kam mir schon immer seltsam vor: Wie kann etwas, das harten Fels mühelos zermalmt, so wehrlos sein?
Die Reste der einst so stolzen Gletscher machen mich auf eine ähnliche Weise traurig wie der Anblick älterer Ladeninhaber, die hinter dem Schaufenster ihres aus der Zeit gefallenen Einzelhandelsgeschäfts allein an der Theke sitzen. Der Wunsch, alles möge so wie früher sein, trifft auf das Wissen, dass es vorbei ist.
Die Existenz der Eiskapelle war ein Mittelfinger an die Klimaerwärmung
Inmitten dieser tauenden Tristesse der Alpen aber gab es ein Symbol des Widerstandes. Ein kleiner Lawinenkegel, nicht mal ein echter Gletscher, der gegen die Wärme rebellierte. So viel Schnee rutscht jeden Winter aus den steilen Flanken des Watzmanns bei Berchtesgaden, dass er sich im Talschluss zu Eis verdichtet. Auf einer Höhe von nur 900 Metern, wo im Sommer zweistellige Plusgrade herrschen und Touristen in Badehose in den Königssee springen, hält sich das Eisfeld hartnäckig. Darin lag, durch abfließendes Schmelzwasser ausgehöhlt, eine blauglitzernde Höhle, die Eiskapelle. Ihre bloße Existenz war stets tröstlich für mich, wie ein Mittelfinger an die Klimaerwärmung: Schaut, hier bin ich. Eine filigrane Eishöhle mitten im warmen Tal, all der Zerstörung trotzend.
Als die Eiskapelle vergangene Woche einstürzte, war gerade meine Tante aus den USA zu Besuch. Sie und mein Vater sind im Schatten des Watzmanns aufgewachsen, beide sind inzwischen um die 80 Jahre alt. Als mein Vater ins Wohnzimmer kam von dem Einsturz erzählte, wirkte er erschüttert und ratlos. Die Eiskapelle, sagte er, habe es doch immer gegeben. Er holte seinen Kletterführer heraus, ähnlich vergilbt wie die alten Gletscherfotos in den Hütten, und zeigte mir darauf ein Foto der Watzmann-Ostwand. Unten sieht man das Schneefeld.

Meine Tante erzählte davon, wie sie dort früher im Sommer Ski gefahren sind, auf dem Lawinenkegel, unter dem die Höhle liegt. Im Archiv des Bayrischen Rundfunks sahen wir uns die Aufzeichnung des Skislaloms aus dem Jahr 1963 an, bei dem ihre beste Freundin Christl Geiger den zweiten Platz gewann.

Das Schneefeld ist seit jenem Rennen immer weiter abgeschmolzen, fast eine Million Kubikmeter hat es verloren. Schon seit den 70ern fährt niemand mehr im Sommer mit Ski darüber. Aber die funkelnde Eiskapelle hatte sich gehalten, Jahre, Jahrzehnte.
Ihr Einsturz kommt mir nun vor wie der Schlag jener Uhr, mit der Klimaschützer gern die Dringlichkeit des Kampfs gegen die Erderwärmung verdeutlichen. Kurz vor zwölf sei es, sagen sie dann. Für das Eis der Alpen hat es vergangene Woche zwölf geschlagen.