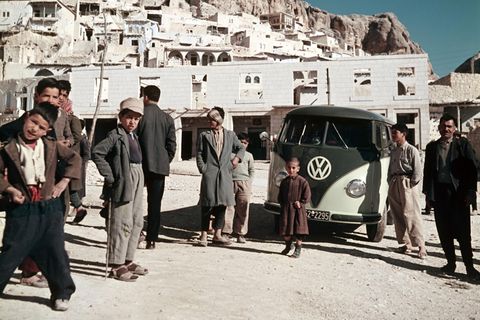Ihr Vermögen wächst im Ozean. Im Schein des Vollmondes geht Evelyne Razdwamalala zum Strand, durch das Hüttenlabyrinth von Ambolomailaka im Südwesten Madagaskars. Auf ihrem Kopf balanciert sie einen leeren Plastikbottich. "15 Monate haben wir auf diese Nacht gewartet", sagt sie. So lange dauert es, bis die Seegurken in ihren Gehegen ausgewachsen sind.
Am Strand wartet Razdwamalala nun mit den anderen Frauen darauf, dass sich das Meer zurückzieht. Immer schwerer werde es für die Familien, mit dem Fischen allein genug zu erwirtschaften, sagt sie. Die Aufzucht der Seegurken sei daher von entscheidender Bedeutung.
Die Aquafarmerinnen arbeiten im Auftrag der Firma Indian Ocean Trepang (IOT). Trepang ist das indonesische Wort für eine getrocknete Seegurke, wie sie in Asien rehydriert und etwa in Suppen gekocht wird. Bei Menschen aus der westlichen Welt löste die gallertartige Speise stets Befremden aus. Doch ein Kilogramm getrocknete Seegurken kann, je nach Art, Größe und Qualität, in Asien bis zu 1500 Euro einbringen.
Weltweit existieren mehr als 1700 Arten von Seegurken
Die Frauen waten ins dunkle Meer hinaus. Vor ihnen liegen 16 Felder, je 4500 Quadratmeter groß, pro Gehege wurden 3500 Seegurken ausgesetzt, jede braucht etwas über einen Quadratmeter Platz. Tagsüber graben die Tiere sich in den Sand, abends kommen sie wieder zum Vorschein.
Der Katalog der Seegurken umfasst mehr als 1700 Arten, manche leben am Grund der Tiefsee, andere in Küstenregionen. Vor Madagaskar ist die gräuliche Holothuria scabraheimisch, sie gilt in Asien als Delikatesse.
Leben mit der Gurke

Leben mit der Gurke
Evelyne Razdwamalala taucht. Mit einer wasserspuckenden Seegurke, so lang wie ihr Unterarm, kommt sie wieder an die Oberfläche. Ein Tier nach dem anderen landet in den Bottichen der Frauen. Morgen werden die Männer nach verbliebenen Seegurken tauchen. Zusammen werden sie sie ausnehmen, abkochen und schrubben, bevor IOT sie abholt. Den Erlös teilen die 45 Mitglieder der Kooperative von Ambolomailaka auf. Zuletzt habe sie 150 000 madagassische Ariary verdient, sagt Razdwamalala. Das entspricht etwa 30 Euro – genug, um ein Kind ein Jahr lang zur Schule zu schicken.
Entlang der Küste südlich der Stadt Toliara sind bereits 570 Familien aus sechs Dörfern involviert. Die Firma IOT hat dort Unterwassergehege auf 670 000 Quadratmetern gebaut, setzt die Jungtiere darin aus und kauft den Einheimischen die erwachsenen Seegurken wieder ab. Sie werden in einer Fabrik getrocknet, für den Export verpackt und von dort aus über Asien verteilt. Weil sogar ein Fünfjähriger diese Tiere fangen könnte, sind die begehrten Arten beinahe ausgerottet – wie die Holothuria scabravor Madagaskar.
Der Meeresbiologe Gildas Todinanahary von der Universität Toliara arbeitet daran, den Ozean nachhaltig zu nutzen. "Unsere Aquakulturen sind ein Weg, der Umweltzerstörung zu begegnen", sagt der 37-Jährige. Sein Institut für Fischerei- und Meereswissenschaften hat die künstliche Befruchtung der Seegurken und ihre Aufzucht mitentwickelt und geholfen, das Geschäftsmodell von IOT zu etablieren.
Einige Dörfer weiter, auf einer Halbinsel, knotet Lizy Tovo kleine Teile von Rotalgen an eine Leine, die sie später im Meer aufziehen wird, ein willkommener Nebenerwerb. Mit dem letzten Seegurkenfang hat sie immerhin 500 000 Ariary verdient, etwa 100 Euro. "Der Nachteil ist die lange Wartezeit, bis die Seegurken ausgewachsen sind und wir Geld bekommen", sagt sie. "Doch dank der Aquakultur ist es für uns leichter geworden, etwas zu leihen."