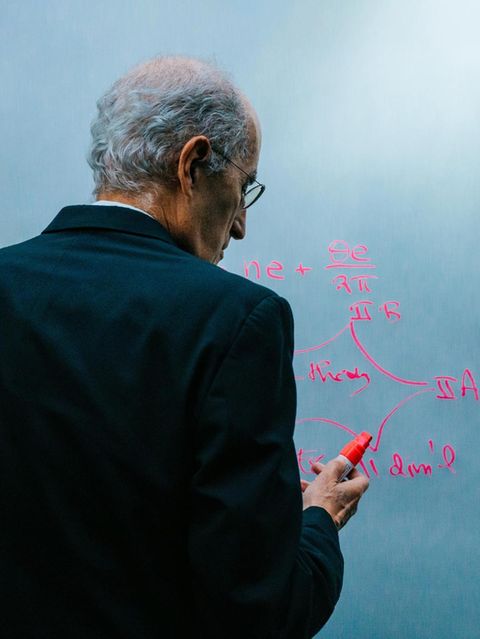400 000 Briten verunglücken beim Gärtnern
Es gibt viele Gartentheorien. Die einfachste, einleuchtendste hat mir Tim Smit erläutert: "Wenn du in einem Garten nicht lieben kannst, wenn du dort nicht träumen oder dich betrinken kannst - asphaltier ihn doch, wozu ist er sonst gut!" Soweit Tim Smit, Initiator des Eden Project in Cornwall, des größten Gewächshauses der Welt. Keine Frage, die Geschichte des englischen Gartens ist eine einzige große Liebesgeschichte. Als erster Engländer bekam Rudyard Kipling 1907 den Nobelpreis für Literatur. Das Preisgeld investierte er in seinen Garten in Sussex. Er legte einen Teich an und kaufte ringsum viel Land, um es unbebaut zu erhalten, als Grüngürtel seines Refugiums Bateman's.
An der Wand seines Arbeitszimmers findet der Besucher Kiplings Garten-Credo, aquarelliert und in Versen: The Glory of the Garden. "Unser England ist ein Garten", heißt es da, jeder kann gärtnern, kein Bein ist zu dünn dafür und kein Kopf zu dick, schon "Adam war ein Gärtner". Kein Zweifel, Adam war Engländer.
Jährlich verunglücken 400 000 Briten beim GärtnernKiplings Verherrlichung des Gartens, biblisch verwurzelt und patriotisch verklärt, gehört zur Nationalfolklore wie der Regen, der die Insel der Gärtner so reichlich segnet, als sei's ein Zeichen des Himmels. "Gott der Allmächtige pflanzte zuerst einen Garten, und dies zu tun ist in der Tat das reinste Vergnügen des Menschen", schrieb der Philosoph Francis Bacon 1625. Seither hat sich dieses Vergnügen ausgewachsen zu einem veritablen Faktor der Volkswirtschaft. Gärtnern, noch vor Sport, ist Englands größte Freizeitindustrie. Seit Jahrzehnten gibt es keine populärere Radiosendung als "Gardener's Question Time". Naturgemäß gibt es auch nirgendwo auf der Welt so viele Gartenunfälle wie in England. Durch Elektroschock am Rasenmäher, explodierende Barbecues, Wespenstiche und giftige Pflanzen sterben im Jahr durchschnittlich 50 Menschen in britischen Gärten; rund 400000 werden verletzt. So die Statistik der Royal Society for the Prevention of Accidents. Doch solche Gefahren können die englische Gartenlust nicht erschüttern, sie gehören nun einmal dazu wie die Schlange zum Paradies.
Im englischen Garten wurde der Absolutismus besiegt
Wo sonst in Europa genoss das Gärtnern so pragmatisch die ungeteilte Gunst des Volkes und der Intellektuellen, der Bürger und des Adels? Friede den Hütten, Krieg den Palästen, tönte es vom Kontinent. Cottagegärten, feudale Parks: Aus dem englischen Echo sprach der Common Sense einer Gesellschaft, die sich mit ihren Klassenunterschieden auch im Grünen arrangierte. Dass lange vor der Französischen Revolution ein König in London seinen Kopf verlor, war ein Betriebsunfall. Tatsächlich fand die Glorious Revolution im Garten statt. Seit dem frühen 18. Jahrhundert fegte der furor hortensis, wie die Zeitgenossen ihn nannten, Britanniens Barockgärten hinweg, und befreit vom absolutistischen Regelzwang zeigte sich die Natur von ihrer scheinbar natürlichsten Seite, als Landschaftspark. So wurde der Englische Garten zum Begriff, zur europäischen Mode, ein Stück Freiheit made in Britain wie das Parlament.
Das Grün als Kunstwerk
"Gärten werden mit den Empfindungen des Dichters und den Augen des Malers gestaltet", erklärte der geniale Landschaftsarchitekt Capability Brown, der Land ummodellierte, als sei er Gott und Maulwurf in Personalunion. Sein Zeitgenosse Horace Walpole, Schriftsteller und Sohn eines Premierministers, gab der neuen Gartenbewegung den ästhetischen Segen: "Die Poesie, die Malerei und das Gärtnern, oder die Wissenschaft von der Landschaftsgestaltung, werden von Menschen mit Geschmack für immer als drei Schwestern gesehen werden, oder als die drei neuen Grazien, welche die Natur schmücken." Auch darin, in der Gleichstellung der grünen Kunst mit den anderen schönen Künsten, ging England dem übrigen Europa voran.
Der Garten der Queen ist selbst für Staatsbesuche tabu
Und heute? In New Britain bröckeln die Traditionen, aber die Gartenkunst floriert. Und die Gartenlust geht über alles. Warum verkaufte der Duke of Northumberland seinen Raffael, die berühmte "Nelkenmadonna", zuvor nur als Leihgabe in der National Gallery zu sehen? War der Herzog plötzlich verarmt? Brauchte er die Kunst-Millionen zur Tilgung von Steuerschulden? Oder für eine neue Yacht? Nein, er benötigte das Geld für den Familiensitz in Alnwick Castle. Allein die Neugestaltung des Gartens soll 42 Millionen Pfund kosten.
Kein Staatsbesuch in ihrer mehr als 50-jährigen Amtszeit habe Queen Elizabeth II. mehr echauffiert, heißt es, als der Besuch des amerikanischen Präsidenten George W. Bush im November 2003. Nicht wegen politischer Differenzen: Bushs Hubschrauber hätten Rasen und Sträucher im Garten des Buckingham Palace beschädigt, seine Sicherheitsleute seltene Pflanzen zertrampelt, kurzum, so die nationale Presse, die Amerikaner hätten den königlichen Garten wie eine texanische Viehweide behandelt.
Nur an Dianas Ehrenhain scheiden sich die Geister
Groß ist das Bedürfnis der Engländer, ihre Toten nicht nur mit Blumen, sondern gleich mit Gärten zu ehren. Gärten, keine Frage, sind erfreulicher als die meisten Sockelmonumente. Doch hat die Inflation der Memorial Gardens auch exzentrische Züge. Seit 1997 gibt es einen Gurkha Memorial Garden mit ausschließlich nepalesischen Pflanzen, ein Stück Himalaya in Hampshire, zur Erinnerung an diese Spezialtruppe der britischen Armee. Auch die Frauen von Greenham Common, die jahrelang ein Stück Land in Berkshire besetzt hatten aus Protest gegen die dort stationierten Atomraketen, forderten einen Garten, zur Erinnerung an ihren Friedenskampf. Wahrhaft bizarr aber war der Ruf nach einem Garten für die tote Prinzessin Diana, die sich nicht im Geringsten für Gärten interessierte. Allerdings, so heißt es, habe Prinz Charles in Camilla Parker Bowles' Gemüsegarten um Dianas Hand angehalten. Nun sollten mehr als sechs Hektar von Kensington Gardens umgestaltet werden zu einem riesigen horticultural shrine in her honour. Das konnte eine Bürgerinitiative gerade noch verhindern - wahrscheinlich die erste "Stop the garden!"-Bewegung im Königreich der Gärtner.
Drei Instiutionen fördern die GartenlustSeit mehr als 30 Jahren lebt der französische Star-Koch Raymond Blanc nun unter den Engländern. Introvertiert und kühl wirkten sie, sagt Monsieur Blanc, doch dieser Eindruck täusche. "Sie zeigen ihre Romantik nicht im Essen oder beim Sex, aber in ihren Gärten siehst du, wie die Leidenschaft aus ihnen herausbricht." Tief reichen die Wurzeln dieser Passion in den kollektiven Humus der Nation. Vor allem drei Institutionen haben die englische Gartenlust wesentlich befördert: die Royal Horticultural Society (RHS), der National Trust und das National Gardens Scheme. Schon John Evelyn, Tagebuchschreiber und Garten-Enthusiast des 17. Jahrhunderts, träumte von einem "Elysium Britannicum", einer "Society of the Paradisi Cultores". Populärer Ableger dieser Idee ist die 1804 gegründete Royal Horticultural Society. Wer wirklich potty about plants ist, besucht die ständige Mustergartenschau der RHS, die rund 100 Hektar großen Wisley Gardens in Surrey. Was immer es an neu gezüchteten Blumen und Pflanzen gibt, von dort verteilt es sich mit Gütesiegel in die Gartenzentren und Vorgärten im ganzen Land. In ihrem Hauptquartier in Westminster hütet die Society eine der bedeutendsten botanischen Bibliotheken der Welt, die Lindley Library.
Die Gartensaison hat viele Termine
Höhepunkt des königlichen Vereins- und Gartenjahres aber ist die Chelsea Flower Show im Mai. Sie gehört zum social calendar wie Glyndebourne, Ascot oder Wimbledon, eine Londoner Fashion Week der Gartenfans, so populär, dass die RHS inzwischen noch eine weitere organisiert, die Hampton Court Palace Flower Show im Juli. Zur Royal Horticultural Society gehören mehr als 300000 Mitglieder. Zehnmal so viel hat der National Trust, Englands einflussreichste Umwelt- und Denkmalschutzorganisation. Seit seiner Gründung 1895 restauriert und erhält der Trust auch historische Gärten; heute sind es 160, darunter solche Klassiker wie Sissinghurst, Nymans und Stowe, Hidcote und Biddulph Grange. Auch eine der meistfotografierten englischen Landschaften gehört dem National Trust, Stourhead Garden. Stourhead hat in der Saison täglich bis zu 1000 Besucher, etwa 250000 im Jahr. So hatte sich der Londoner Bankier Henry Hoare das eigentlich nicht vorgestellt, als er um 1740 in Stourhead sein Refugium plante, mit der in Stein gemeißelten Devise von Vergil: Procul, o procul este profani - Bleibet fern, oh ihr nicht Eingeweihten!
17 Millionen Gartenbesucher jährlich
Doch schon damals wurden Gärten besichtigt, sie waren Teil der Kavalierstour wie die Gemäldegalerien der Herrenhäuser. Kein Reisender, kein Reiseführer, der die englischen Parks nicht pries, von Fürst von Pückler-Muskau bis Günter Kunert, von Johanna Schopenhauer bis Henry James. Heute wird es schon etwas eng in manchen Gärten. In Sissinghurst gibt es timed tickets, zeitlich begrenzten Eintritt. Und die Zahl der Menschen, die Grünanlagen besuchen, wächst doppelt so schnell wie die der Besucher von Museen und historischen Sehenswürdigkeiten. Derzeit werden jährlich rund 17 Millionen Gartenbesucher registriert. Zu diesem neuen Furor hortensis hat, neben dem National Trust, noch eine andere Privatinitiative wesentlich beigetragen, das National Gardens Scheme.
Garden visiting is a serious sport Unter diesem Zeichen finden sich Tausende von Engländern bereit, an bestimmten Tagen des Jahres ihre Privatgärten besichtigen zu lassen. Garden visiting ist unter Engländern a serious sport. Punkte sammelt nicht, wer Ableger klaut, sondern wer einen Garten besucht, der nur an einem einzigen Nachmittag im Jahr geöffnet ist, besser noch: zum ersten Mal überhaupt. Solche Trouvaillen findet man im Yellow Book, dem dottergelben, alljährlich aktualisierten Adressbuch des National Gardens Scheme. Rund 3500 Privatgärten gehören inzwischen dazu. Manche der schönsten Gärten allerdings sind nicht einmal dort verzeichnet. Denn das Yellow Book ist auch ein beliebtes Handbuch für Diebe. Sollte dieses Werk Sie eines Tages auch nach Bramfield führen, ein Dorf in Suffolk, dann wundern Sie sich nicht über die wellenförmige Backsteinmauer, die wie ein Betrunkener neben der Straße herläuft. Solche crinkle-crankle walls waren eine Mode in Suffolker Gärten des 18. und 19. Jahrhunderts. In den Nischen dieser Serpentinenmauern finden Obstbäume und Blumen Schutz und zusätzliche Wärme. Der Crinkle-Crankle Wall gegenüber liegt die Kirche von Bramfield. Wer nun dem Schöpfer aller Gärten auf seinen Knien dankt, der kniet dort fast schon im Paradies: auf grünen, blühenden kneelers, wiesenweichen Kniekissen, von den frommen Gärtnerinnen des Dorfes bestickt mit lauter Blumen, mit Narzissen, Rosen, Mohn und Margeriten, mit Geißblatt und Veilchen. Wir sind aus einem Garten vertrieben, so erzählt es die biblische Geschichte. Seither suchen wir das Paradies. Auf dem Weg dorthin gibt es die englischen Gärten.
- Engländer fliegt mit 100 Luftballons durch die Luft
- Mousehole: Eins der schönsten Fischerdörfer Englands
- Die zehn schönsten Gärten Englands