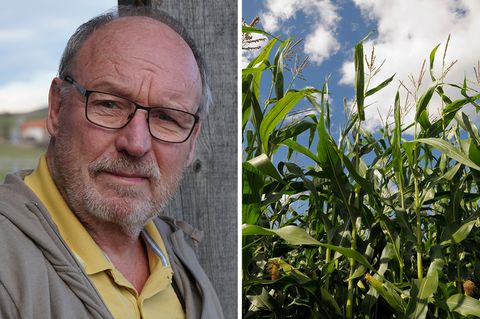GEO.de: Krefelder Insektenforscher haben einen Rückgang der Insekten um bis zu 80 Prozent im vergangenen Vierteljahrhundert diagnostiziert. Trotzdem reden alle nur vom heißen Sommer und vom Klimawandel. Wie kommt das?
Volker Angres: Das Klimathema ist offensichtlicher, allein durch die Wetterextreme. Wir haben verheerende Stürme, Kalifornien brennt, was auch auf eine viel zu lange anhaltende Trockenheit zurückzuführen ist. Der Klimawandel ist sichtbar. Der Artenschwund nicht. Was weg ist, kann man nicht mehr zeigen. Daher rührt vielleicht auch eine gewisse Blindheit der Medien, was das Thema biologische Vielfalt angeht. Zudem wird rund um die UN-Biodiversitätskonferenzen eine extrem schlechte Pressearbeit gemacht. Dabei ist das Thema mindestens so wichtig wie der Klimawandel.
Das Bienensterben hat es immerhin noch zu einiger Popularität gebracht. Sind uns Feldlerche und Hauhechel-Bläuling egal?
Bei Bienen fällt uns als erstes Honig ein. Viele fänden es furchtbar, wenn es keinen mehr gäbe. Hinzu kommen massive Bienensterben wie in das in der Rheinebene im Jahr 2008, das für Schlagzeilen gesorgt hat. Eine Feldlerche dagegen … ich behaupte, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, wie sie aussieht. Vom Hauhechel-Bläuling ganz zu schweigen. Da macht sich eine starke Erosion des Wissens bemerkbar.
„Man kann nur schützen, was man auch kennt“, sagen Umweltbewegte. Viele Kinder und Jugendliche haben aber kaum Kontakt zur Natur. Welche Rolle spielt Umweltbildung?
Es gibt zum Beispiel in den Naturschutzverbänden viel ehrenamtliches Engagement in dieser Richtung. Aber die Lehrpläne der Schulen machen mir Sorgen. In Baden-Württemberg etwa wird der Biologie-Unterricht abgeschafft, beziehungsweise in andere Fächer integriert. Stattdessen müsste man ein neues Fach erfinden, ich nenne es mal „Ökosystemlehre“, die uns bestimmte Mechanismen in Ökosystemen näherzubringt, die für unser aller Überleben wichtig sind. Da könnte man auch die Feldlerche einbauen, die übrigens nur bei uns ist, weil die Wälder, die Deutschland einst bedeckten, abgeholzt wurden. Feldlerchen brauchen nämlich offene Landschaften. Auch an den Universitäten sollte es bei Studiengängen wie Volks-, und Betriebswirtschaft oder Jura ein Pflichtsemester Ökosystemlehre geben. Damit die Leute, die später vielleicht mal in einem DAX-Vorstand sitzen, begreifen, dass ihre Entscheidungen möglicherweise sehr weitreichende Folgen haben.
In Ihrem Buch benennen Sie auch Verantwortliche für das Artensterben in Deutschland ...
Es sind alle diejenigen, die ihre eigenen Interessen im Sinne von Lobby vor das Wohl der Gesellschaft stellen. Das sind zum Beispiel die konservativen Landwirtschaftsverbände. Oder die chemische Agrarindustrie. Übrigens war die Art der Landwirtschaft, für die sie stehen, nicht schon immer falsch. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa am Boden lag, war das das richtige Konzept, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen den Hunger zu bekämpfen, Menschen in Arbeit und Lohn zu bekommen. Allerdings hat sich in den 50er Jahren kein Mensch Gedanken über die Umwelt gemacht. Das ist lange vorbei. Es geht jetzt nicht mehr nur darum, unseren Wohlstand zu mehren. Jetzt müssen wir darauf achten, dass die Ökosysteme funktionieren.
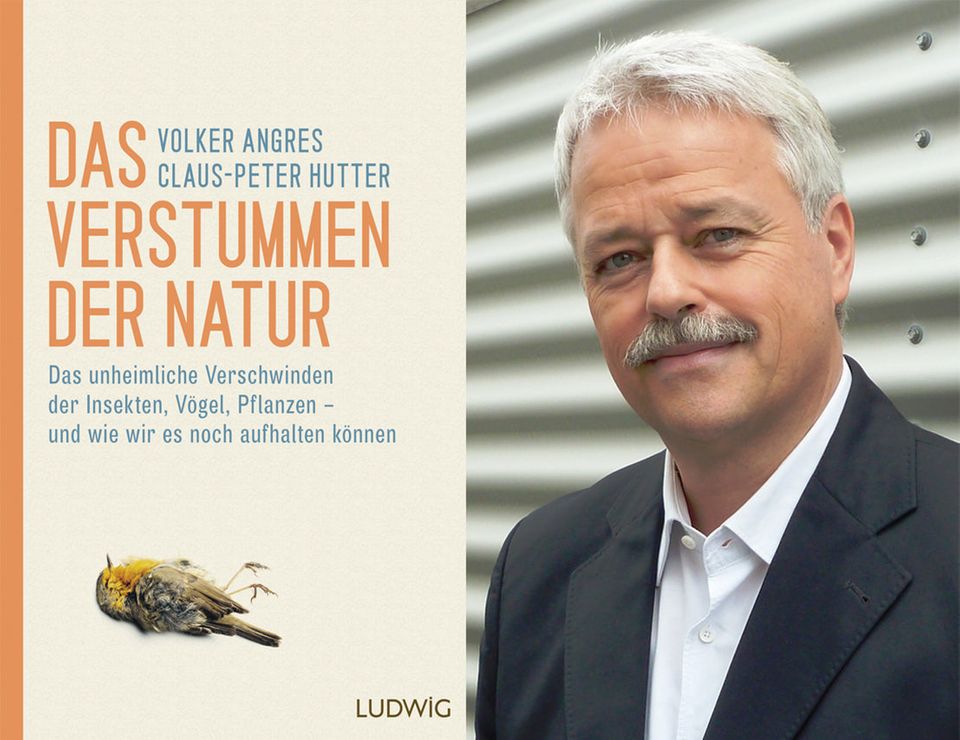
Zum Beispiel, indem wir Glyphosat oder Neonicotinoide verbieten, wie Umweltverbände fordern. Was ist daran so schwierig?
Zunächst einmal sind solche Produkte, beziehungsweise die enthaltenen Wirkstoffe, irgendwann einmal höchst offiziell zugelassen worden. Wer damit Geld verdient, würde bei einem Verbot Schadenersatz verlangen. Wir müssen uns auch anschauen, wie solche Wirkstoffe zugelassen werden. Und müssen feststellen, dass die notwendigen Studien, die beweisen sollen, dass die Mittel wirklich unschädlich sind, zum allergrößten Teil genau von denen bezahlt werden, die diese Stoffe in den Markt bringen wollen. Damit macht man den Bock zum Gärtner. Eine Alternative wäre eine Stiftung, die Gelder von der agrochemischen Industrie einsammelt und dann neutral Studien vergibt. Damit ließe sich zumindest die direkte Einflussnahme der Industrie auf das Studiendesign und auf das Ergebnis deutlich reduzieren.
In Sharm El-Sheikh treffen sich gerade 80 Umweltminister aus aller Welt, um über Strategien gegen das Artensterben zu beraten. Auf der nächsten Biodiversitätskonferenz 2020 in Peking soll das Abkommen verabschiedet werden. Macht Ihnen das Mut?
Die Erfahrung von vielen anderen internationalen Konferenzen lehrt, dass dort sehr dicke Bretter gebohrt werden müssen, und dass es sehr lange dauert, bis man alle Staaten an Bord hat. Und genau das ist notwendig. Es nützt nämlich nichts, wenn ein Land viel für den Artenschutz tut. Wir brauchen, genau wie beim Klimaschutz, eine globale Strategie. Und ich habe die Hoffnung, dass es da vorangeht, denn die UN-Biodiversitätskonferenzen waren, was die Ergebnisse betrifft, deutlich erfolgreicher als die UN-Klimakonferenzen. Es geht da ja nicht nur um Artenvielfalt, sondern etwa auch um Gerechtigkeit. Früher haben Hersteller aus aller Welt Pflanzen und Tiere des Regenwaldes genutzt, um neue Arzneien zu entwickeln – und damit viel Geld zu verdienen. Mittlerweile müssen die Herkunftsländer beteiligt werden.
Trotzdem – Ihr Fazit klingt nicht sehr optimistisch. Sie zitieren Klaus Töpfer, den ehemaligen CDU-Bundesumweltminister, der nach einem offiziellen Interview zu Ihnen sagte: „Es wird sich nichts ändern – bis zur nächsten Katastrophe“ ...
Ich durfte neulich eine Gesprächsrunde zu Ehren seines 80. Geburtstages moderieren. Da habe ich genau diese Anekdote erzählt. Nicht nur er – auch andere in der Runde haben den Eindruck bestätigt, dass erst bei einer Katastrophe der Druck auf die Politik so groß wird, dass sich ein kleines Zeitfenster, vielleicht Tage oder sogar nur Stunden, für Entscheidungen auftut. Erst wenn die Krise ihr vorerst größtes Ausmaß erreicht hat, bekommt man Politiker dazu, zu einem Thema Stellung zu beziehen und über Maßnahmen nachzudenken, siehe Fukushima. So lange die Wissenschaftler nur "gepflegt" Alarm schlagen, passiert so gut wie gar nichts.
Sollen die Umweltbewegten jetzt also lieber die Füße stillhalten? Damit die Katastrophe schneller kommt?
Das würde ich so nicht unterschreiben. Aber klar ist: Je heftiger es wird, desto mehr wird diskutiert und berichtet. Und desto größer ist die Bereitschaft der Politik, zu helfen, Gesetze zu ändern oder Gelder freizugeben.
Macht Ihnen Ihr Job als Leiter der ZDF-Umweltredaktion eigentlich noch Spaß?
Ja, es ist super interessant! Ich habe vorher zehn Jahre lang Wirtschaftsfernsehen gemacht. Das fand ich am Ende stinklangweilig. Immer dieselben Themen und fast immer dieselben Köpfe. Im Umwelt-, Natur- und Nachhaltigkeitsbereich treffe ich am laufenden Band hoch spannende Leute, Querdenker und Andersmacher. Die machen einfach. Diese Motivation und diesen Spirit finde ich klasse.