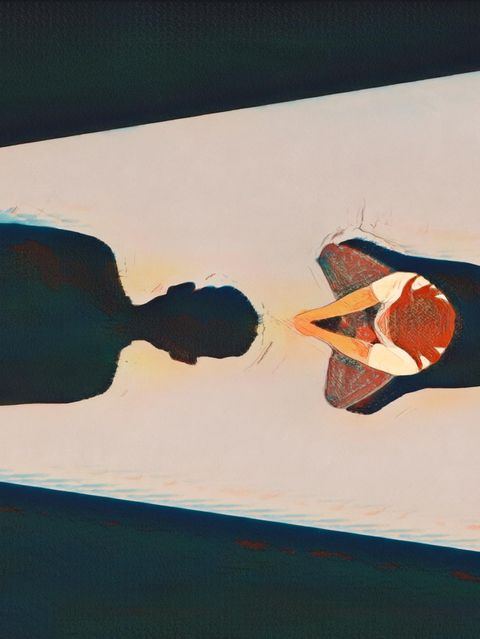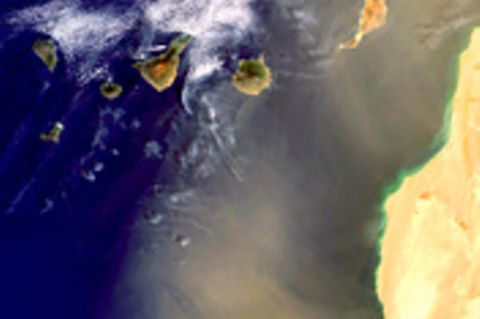Ich soll dieses Heft mit dem Blick eines Laien gegenlesen und mich dazu äußern, ob ich alles verstanden habe. Gleich in den ersten Beiträgen habe ich vier Dinge nicht verstanden, ich habe die Redaktion gebeten, mir dies zu erklären. Erstens. In dem Beitrag über die Sahara steht, dass man dort die Skelette von ertrunkenen Menschen gefunden habe. Ich möchte gern wissen, woran man bei einem Skelett merkt, dass der ehemalige Skelettbesitzer den Ertrinkungstod gestorben ist.
Jetzt könnte die Antwort natürlich lauten, dass die Skelette in ausgetrockneten Seen gelegen haben. Auf diese Idee bin ich ja schon selber gekommen. Es könnte doch aber auch ein Bestattungsritus gewesen sein, das heißt, der frühe Sahara-Mensch hat seine Verblichenen nicht vergraben, sondern in die damals reichlich vorhandenen Gewässer der Sahara-Seenplatte getan. Das tun doch auch die Inder. Manche Inder, besser gesagt. Man soll nicht pauschalisieren.
Zweitens. Die Wüstenstaaten haben es bekanntlich in der Wirtschaftspolitik nicht leicht, außer wenn Öl bei ihnen fließt. Diesem Heft entnehme ich, dass der Wüstensand aufgrund seiner Mineralien relativ fruchtbar sei. Das heißt, wenn man genügend Wasser auf den Sand gießt, dann blüht die Wüste.
Das habe ich schon als Kind in dem Film "Die Wüste lebt" gesehen, einem Film von Walt Disney. Ein toller Film war das. Es regnete, und die Wüste verwandelte sich in dem Film innerhalb von 30 Sekunden in ein tropisches Paradies. Wenn aber die Wüste blüht, sobald es regnet, wieso exportiert man dann nicht einfach den Wüstensand in regenreiche Gebiete, zum Beispiel nach Deutschland? Ich habe einen Kleingarten gehabt, ich weiß, wie schwer es oft ist, in Deutschland etwas zum Blühen zu bringen.
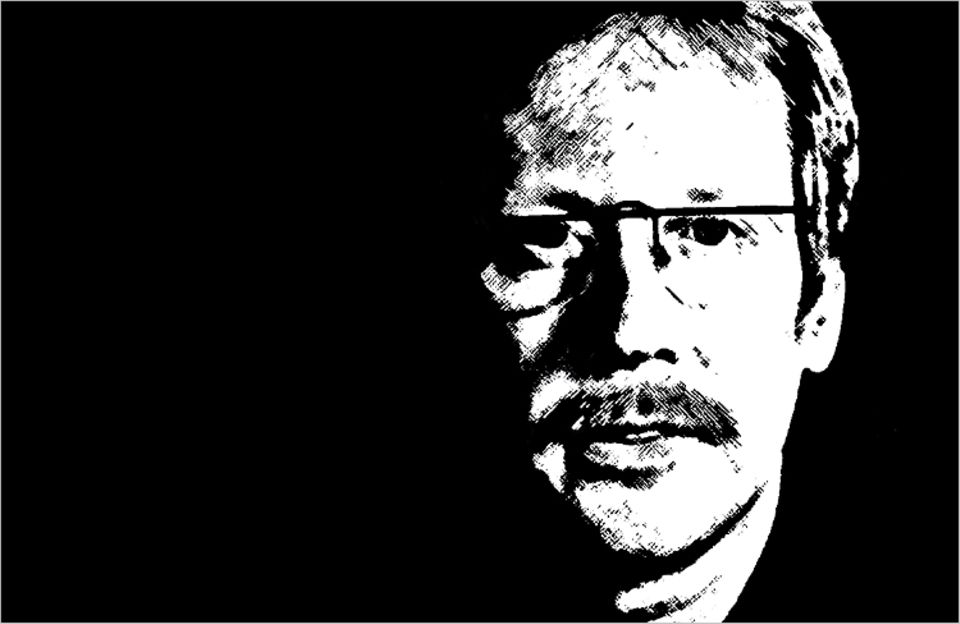
Drittens. Unter der Sahara befinden sich gewaltige Wasserspeicher, die ausreichen würden, die Wüste 40 Meter hoch zu überfluten. Ich verstehe ohne weiteres, dass es nichts Entscheidendes bringen würde, dieses Wasser nach oben zu pumpen, weil es in der Hitze blitzschnell verdunsten oder im Sand, der erst mal kurz blüht, langfristig nutzlos versickern würde.
Das ist ja eine wasserwirtschaftlich total verkorkste Situation da unten in der Wüste. Aber ich bin kürzlich in der Sauna gewesen und dort hatten sie, für sechs Euro die Flasche, Mineralwasser von den Fidschi-Inseln. Fast alle in der Sauna haben Fidschi-Wasser getrunken. Das ist so ein Lifestyle-Trend zurzeit, man trinkt exotisches Mineralwasser, obwohl das wegen der langen Transportwege ökologisch eine verwerfliche Tat ist. Warum verkaufen die Wüstenstaaten nicht einfach Mineralwasser? Tschadquelle? Das wäre doch noch exotischer als Fidschi-Wasser. Das würden die wohlhabenden Dekadenzler in den europäischen Saunen für sechs Euro in sich hineinschütten, und der Tschad hätte ein weltmarktfähiges Lifestyle-Produkt mit hoher Rendite.
Das Wichtigste an einer Wüste ist der Sand. Jetzt weiß ich also, nach der Lektüre der ersten Beiträge, dass man unter "Sand" streng wissenschaftlich eine Ansammlung von Körnern steiniger, meist steiniger oder zumindest vornehmlich steiniger Konsistenz versteht, die einen Durchmesser von mindestens 0,063 Millimetern und höchstens zwei Millimetern haben. Darauf hat man sich weltweit geeinigt. Ich weiß nun auch, dass Wissenschaftler Körner, die größer als Sand sind, "Kies" nennen - und kleinere Partikel "Staub".
Es gibt Steinwüsten oder Kieswüsten, von Staubwüsten aber habe ich noch nie gehört. Das kommt sicher noch, weil der Sand von der erbarmungslosen Witterung da draußen immer weiter abgeschmirgelt wird. In einigen Millionen Jahren beginnt dann die große Zeit der Staubwüsten, und die letzten Kieswüsten werden unter Naturschutz gestellt.
Im normalen Zivilleben unterscheidet man zwischen "Sand", "Kies" und "Staub" ja rein instinktiv. Mir leuchtet ein, dass es da eine wissenschaftliche Grenze geben muss, wenn ein Forscher von einer Expedition nach Hause zurückkehrt, macht es für die Zuhörer schon einen Unterschied, ob er sagt, ich war monatelang im Sand unterwegs oder im Kies.
Nun die vierte Frage. Wieso beginnt der Kies bei der hübsch runden Zahl von zwei Millimetern, während die offizielle Untergrenze des Sandkorns bei den eigenartig krummen 0,063 Millimetern liegt?
Ich vermute, dass sich bei 0,062 Millimetern eine bestimmte Eigenschaft des Körnchens verändert, vielleicht die Rieseleigenschaft. Jedenfalls ist diese Eigenschaft das, was ein Sandkorn überhaupt erst - wissenschaftlich gesehen - zu einem Sandkorn macht. Das heißt, wir hätten es hier, bei dieser Eigenschaft, mit der geistigen Essenz und der Definitionsgrundlage des Sandes zu tun, mit anderen Worten: mit der auf den Begriff gebrachten Idee der Wüste. Es könnte die Zahl 0,063 aber auch das Ergebnis einer bürokratischen Verhandlung sein, ein Kompromiss zwischen verschiedenen Lagern und Interessengruppen, wie es auch häufig bei Grenzwerten der Europäischen Union der Fall ist.
Es gab vielleicht chinesische Forscher, die alles Steinige unterhalb von 0,065 Millimetern für ganz und gar staubig erklären, während die USA die Staubgrenze erst bei 0,06 ziehen, damit es bei den Antiamerikanern nicht heißt, Amerika staubt. Da hat man sich halt bei 0,063 getroffen. Verstehen Sie? Das wüsste ich gern. Hier nun die Antworten der Redaktion. Zu dem Skelett teilte mir der zuständige Experte mit, es habe sich in einer ungeordneten Körperlage, ohne Grabbeigaben und ohne Spuren von Krokodilbissen kilometerweit vom damaligen Ufer entfernt befunden.
Der Experte räumt aber ein, dass dieser bedauernswerte Mensch auch beispielsweise beim Schwimmen oder Segeln an einem Herzinfarkt gestorben sein könnte. Es ist ja wissenschaftlich vermutlich unbekannt, seit wann es Herzinfarkte und Segeltörns gibt.
Beim Sand ist es so, dass die in ihm enthaltenen Nährstoffe nur deshalb in ihm enthalten sind, weil es in der Wüste fast nie regnet. Bei unserem unwüstigen Wetter würde der Regen den Sand durch Auswaschung recht bald unfruchtbar machen. Die Idee mit dem Mineralwasser aber wurde allgemein als gelungen empfunden. Warum macht der Tschad das eigentlich nicht? Zwar brauchen sie im Tschad selber dringend Wasser, aber von den sechs Euro, die man für das Lifestyle-Wüstenwasser in meiner Sauna vermutlich erlösen könnte, wäre der Tschad in der Lage, mindestens zwölf Flaschen billiges deutsches Mineralwasser zu kaufen. Die müssten dann in den Tschad transportiert werden.
Das klingt verrückt. Aber das ist halt die Globalisierung. Da entscheidet nicht der Verstand, sondern der Markt. Der offizielle Grenzwert für Sandkorngrößen aber hat die Experten tatsächlich ratlos gemacht. Es ist sehr schwierig, herauszufinden, was in den Gehirnen der zuständigen Personen passiert ist, als die führenden Sandgremien der Welt, wie immer sie heißen mögen, sich auf den Sandkorngrenzwert einigten. Vielleicht hängt es mit den Strömungseigenschaften zusammen? Bestimmte Körner werden vom Wasser weggespült. Andere bleiben liegen. Das ist natürlich nur eine Theorie. "Schwache Strömungen transportieren nur noch Schluffe", schrieb mir eine Expertin.
Das, was kleiner als Sand ist, heißt nämlich offiziell "Schluff" - und Staub nur dann, wenn es vom Winde verweht wird. Unter einem Schluff versteht man einen unverfestigten Feinboden von 0,002 bis 0,063 Millimeter Durchmesser, wobei mindestens 95 Prozent der Körner diese Größe besitzen müssen, ansonsten handelt es sich um keinen echten
Schluff mehr, sondern vielleicht um Halbschluff, Scheinschluff oder Teilschluff. Beim echten Schluff unterscheidet man zwischen Grobschluff, Mittelschluff und Feinschluff.
Und bei den Schluffgrößen gibt es tatsächlich zwei rivalisierende Kategorisierungssysteme, die deutsche DIN und die Wentworth-Skala, das heißt, ein Deutscher und ein Chinese meinen nicht unbedingt das Gleiche, wenn sie von einem besonders schönen Mittelschluff sprechen. Wer sich also wirklich intensiv mit den Sandmeeren dieser Erde befasst, der wird um ein Gespräch über den Mittelschluff auf die Dauer wohl nicht herumkommen.