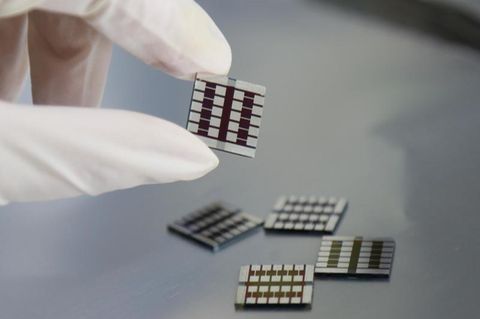Ein riesiger Lorbeerbaum hat die bimbaches, die Ureinwohner von El Hierro, der Legende nach mehrfach vor dem Verdursten gerettet. Hoch oben auf der wasserarmen Vulkaninsel mit ihren bizarren Felsküsten und grünen Feuchtwäldern stand er, und an seinen Blättern kondensierte so viel Feuchtigkeit aus den Wolken des Nordostpassats, dass sich Tümpel unter ihm bildeten. Der heilige Baum, der Garoé, ist deshalb heute noch das Wahrzeichen der kleinsten der sieben kanarischen Inseln. "Und der Garoé des 21. Jahrhunderts, das ist unser Pumpspeicherkraftwerk. Es kämmt mit Windkraft ebenfalls Wasser aus dem Himmel", sagt Juan Manuel Quintero aus El Hierros 5000-Seelen-Hauptstadt Valverde.

Der Mittfünfziger ist der Chef des Wind-Wasser-Kraft-werks "Gorona del Viento", das in der Nähe des Hafens in das schwarze Vulkangestein hineingebaut wurde. Wenn es demnächst in Betrieb geht - dem Plan nach noch im Sommer 2013 -, wird es die 280 Quadratkilometer große Insel mit ihren knapp 11 000 Bewohnern fast vollständig mit erneuerbaren Energien und Wasser versorgen.
Pumpspeicherkraftwerke nutzen Energie in Zeiten, wo sie im Überfluss vorhanden ist, um Wasser in höher gelegene Becken zu pumpen. Dort steht es für Zeiten bereit, in denen das Energie-Angebot knapp ist. Während es durch Fallrohre bergab stürzt, treibt das Wasser dann Turbinen und Generatoren an und produziert Strom. Die Technik ist auch in Deutschland verbreitet, doch die Kombination mit Windkraft und Meerwasserentsalzung macht die mit Umweltpreisen ausgezeichnete El-Hierro-Anlage einmalig - und weltweit übertragbar.
Energieautark mit deutscher Technik
Mit ausgetüftelt hat sie der frühere Wasserbauingenieur Quintero. Nun steht er vor Kakteengewächsen und erklärt die Komponenten: Fünf 70 Meter hohe Enercon-Windanlagen aus Deutschland werden 11,5 Megawatt Strom liefern - weitaus mehr, als die Spitzennachfrage auf der Insel, sieben Megawatt, erfordert. Vor allem in der Nacht, wenn der Stromverbrauch gering ist, wird ein Teil des zusätzlich erzeugten Windstroms die drei Meerwasserentsalzungsanlagen betreiben, die bisher mit Dieselenergie Süßwasser herstellen. Ein anderer Teil wird die Pumpen versorgen, die Wasser aus einem unteren Depot in Küstennähe über zwei Röhren in das obere Speicherbecken auf etwa 700 Meter Höhe hieven.
Türkisblau leuchtet dessen Wasser in der Sonne - es dient gleichzeitig als Trink- und Brauchwasserreservoir der Insel. Bis zu 380 000 Kubikmeter Inhalt kann das Becken aufnehmen; es ist ein ehemaliger Vulkankrater, der mit Folien abgedichtet ist. Wenn der Wind nicht weht, öffnen Mitarbeiter die Ventile und lassen Wasser in das tiefer liegende Becken rauschen. Mit diesem System übersteht die abgelegene Insel im Atlantik vier Tage Flaute. Nur wenn diese länger anhält, müsste die alte Dieselanlage wieder angefahren werden. "Eine natürliche Batterie, wow! Das ist eine Goldmine", entfährt es einem US-Geschäftsmann, der das Werk besichtigt.
Chefingenieur Quintero ist optimistisch, dass sich die rund 65 Millionen Euro teure Investition innerhalb weniger Jahre amortisiert. Die Inselgemeinde besitzt 60 Prozent des modernen "Wunderbaums", der spanische Energiekonzern Endesa 30 und das Kanarische Technologie-Institut zehn Prozent. Gewinne sollen in neue Ökoprojekte reinvestiert werden. Gleichzeitig, erklärt der Technikpionier, werden pro Jahr zwei Millionen Euro für Öl sowie rund 20.000 Tonnen des Treibhausgases CO2 eingespart. Und die Bevölkerung, die bei sinkendem Grundwasserspiegel schon mehrfach von dramatischer Wasserknappheit heimgesucht wurde, bekomme eine nachhaltige Wasser- und Energieversorgung. "Die Fantasie verwandelt sich auf El Hierro in Realität", freut sich Quintero.
Dass es so weit gekommen ist, ist dem Engagement weiterer Visionäre zu verdanken. Der damalige Präsident Tomás Padrón Hernández und sein Stellvertreter Javier Morales begannen bereits in den 1990er Jahren, einen "Plan zur nachhaltigen Entwicklung" auszuarbeiten. Ihnen ging es um eine Perspektive jenseits von hässlichen Bettenburgen, wie sie auf dem nahen Teneriffa stehen. Die einmalige Inselnatur mit ihren kleinräumigen Klimazonen - den Vulkankegeln, Lorbeerwäldern, Feldern und Gärten mit üppigem Blumenbewuchs - sollte geschützt und nur sanfter Tourismus gefördert werden. Im Jahr 2000 erklärte die UNESCO das Eiland zum Biosphärenreservat.
Beatriz Duarte, Managerin der größten Agrargenossenschaft mit rund 600 Mitgliedern, kredenzt in der 4000-Einwohner-Gemeinde La Frontera selbst produzierten Wein und Ananas. Die Bauern ihrer Kooperative bewirtschafteten rund 60 Prozent der gesamten Agrarfläche, erklärt die junge Frau. Genossenschaftspräsident Miguel Angel führt durch eine Plantage nebenan, schiebt Bananenblätter beiseite und zeigt die biologischen Fallen, in denen Spinnen gefangen werden. Zertifizierte Bio-Bananen, -Ananas und -Papaya gebe es bisher kaum, doch faktisch arbeiteten einige Betriebe fast ausschließlich biologisch, berichtet er.
Vom Tourismus-Geheimtipp zur Ökoinsel
"Ökoinsel El Hierro - 100 Prozent erneuerbar", heißt das Ziel. 6000 Fahrzeuge auf El Hierro sollen bis 2020 mit jener Kraft fahren, die der "Garoé des 21. Jahrhunderts" aus dem Himmel holt. Bisher gibt es drei Elektroautos; eines davon, einen silberfarbenen Renault, fährt Inselpräsident Alpirio Armas. Eine innovative Infrastruktur, zu der neben 35 Aufladestationen auch die Förderung von Gemeinschaftsautos, Bussen und Radwegen gehört, ist im Aufbau.
Für Mülllastwagen ist ein ganz besonderer Alternativantrieb vorgesehen: Biodiesel aus Speise- und Frittieröl von Restaurants, Schulmensas und Privathäusern. Eine Anlage, die aus gesammeltem Altöl plus Methanol Biodiesel herstellt, mit dem Nebenprodukt Glyzerin für Kosmetika, ist kurz vor der Fertigstellung. Sie steht auf dem großen Recyclinghof in den Bergen. Es ist kühl hier oben, Anlagenchefin Fabiola Avila verkriecht sich in ihre gelbe Windjacke. "Noch sind wir bei der Bestandsaufnahme", erklärt die engagierte Umweltschützerin. "Aber irgendwann werden wir hier allen Müll zu 100 Prozent recyceln."
El Hierro ist dabei, ein Vorzeigeprojekt für Nachhaltigkeit zu werden. Weil viele Bewohner sich kreativ für ihre Insel engagieren. Und weil die alte Legende vom Garoé moderne Technik inspiriert hat.