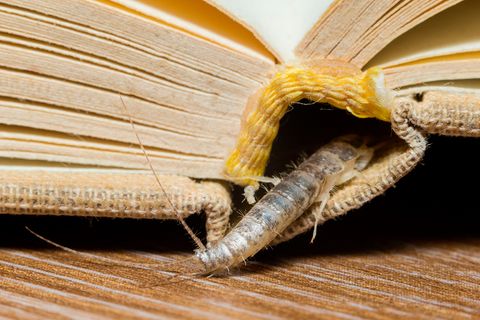Das Bienensterben ist zur Zeit in aller Munde. Zu Recht, denn die Hautflügler sind als Bestäuber in der Landwirtschaft unverzichtbar. Doch auch anderen Insekten geht es schlecht. In den Niederlanden haben Forscher nun Schmetterlinge unter die Lupe genommen. Und sind zu einem alarmierenden Ergebnis gekommen. In ihrer Studie weisen die Insektenforscher nach, dass bei unseren Nachbarn seit 1890 mindestens 84 Prozent aller Schmetterlinge verschwunden sind. Vermutlich, so die Autoren, seien es sogar noch mehr. Von 71 dort heimischen Arten seien 15 bereits ausgestorben, darunter auch Schönheiten wie der Ameisenbläuling und der Große Eisvogel.
Als Grund Nr. 1 für den dramatischen Rückgang haben die Forscher den Verlust von Lebensräumen ausgemacht: Während noch um 1900 rund 40 Prozent des Landes aus blütenreichen Wiesen bestand, sind es heute nur noch drei. Ein weiterer Grund ist die intensive Landwirtschaft: Pestizide und künstlicher Dünger vernichten vielerorts die Futterpflanzen der Schmetterlinge, die oft hoch spezialisiert sind. So braucht etwa der Wundklee-Bläuling die gleichnamige Pflanze zum Überleben, während der Magerrasen-Perlmuttfalter nur auf naturnahen Trockrasenflächen existieren kann.
Die Studie bezieht sich zwar auf die Niederlande, doch im Nachbarland Deutschland ist die Situation ähnlich dramatisch.
Auch in Deutschland grassiert das Schmetterlingssterben
Von den 189 hier heimischen Tagfalter-Arten sind fünf schon ausgestorben. Zwölf sind vom Aussterben bedroht – und fast hundert stehen auf der Roten Liste. Auch hier heißt die Ursache: intensive Landwirtschaft.
Deren Rolle haben Forscher vom Senckenberg Deutschen Entomologischen Institut nun genauer untersucht. Dazu zählten sie auf 21 unterschiedlich genutzten Wiesenflächen östlich von München die Falter. Das Ergebnis: Auf Wiesen, die an intensiv bewirtschaftete Flächen grenzen, finden sich nur rund halb so viele Arten wie auf Flächen in Naturschutzgebieten. Nach Individuen sind es sogar nur ein Drittel.
"Unsere Studie unterstreicht die negativen Auswirkungen der industrialisierten, konventionellen Landwirtschaft auf die Tagfalter-Vielfalt und zeigt, dass dringend umweltverträglichere Anbaumethoden benötigt werden", resümiert Institutsdirektor Thomas Schmitt.
Was jeder tun kann
Während in Bayern nach dem Volksentscheid "Rettet die Bienen" per Naturschutzgesetz ein besserer Schutz für Bienen, Schmetterlinge und Co. erreicht werden soll, können Gartenbesitzer schon jetzt Insekten helfen – etwa mit einer Wildblumen-Wiese und dem Verzicht auf Versiegelung und Unkrautvernichtungsmittel. Auch wer Obst und Gemüse regional, saisonal und bio kauft, hilft Insekten indirekt. Denn die ökologische Landwirtschaft verzichtet auf den Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden und Kunstdünger.