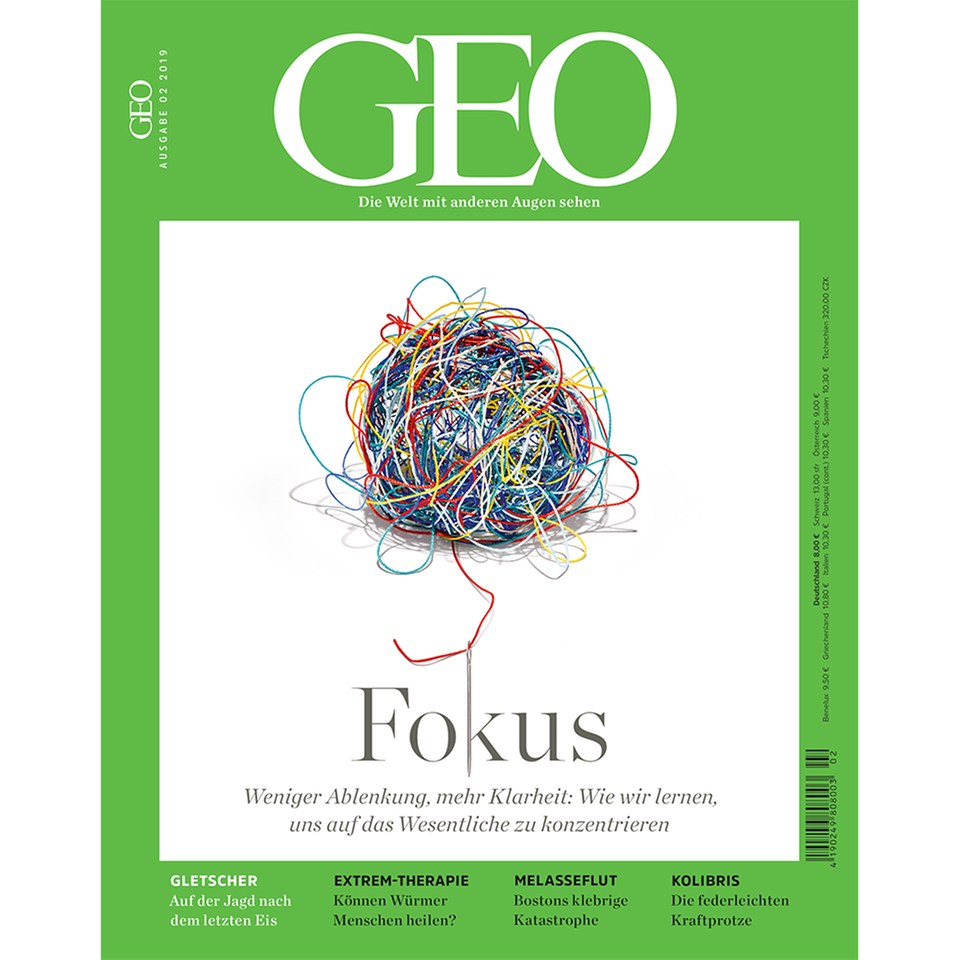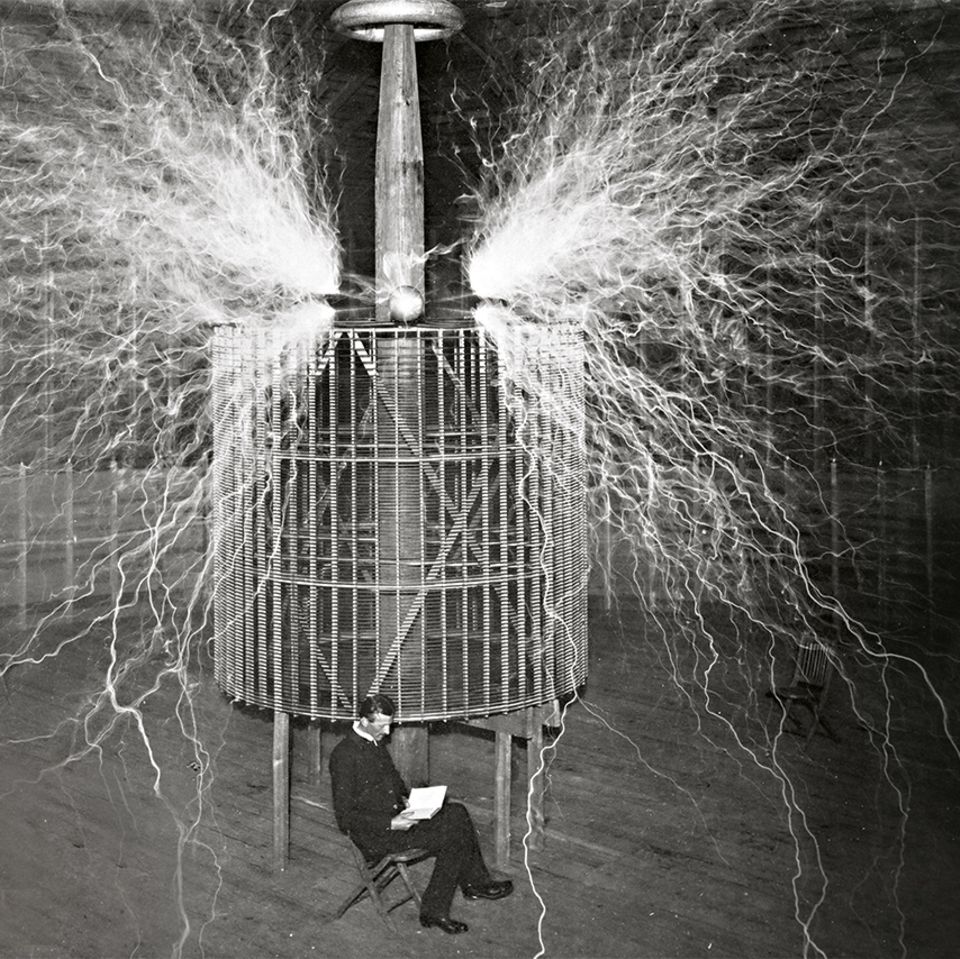Der letzte Tag im Leben des Pasquale Iantosca ist ungewöhnlich schön. Die Mittagssonne blinzelt immer wieder zwischen den Wolken hervor und wärmt die Luft an diesem 15. Januar 1919 auf vier Grad über null, überraschend mild für Boston im Winter. Der Zehnjährige schwitzt in seinen zwei roten Pullovern, übereinandergezogen, weil es die Eltern so wollten.
Pasquales Vater steht am Fenster der Wohnung und behält die drei Kinder auf der anderen Straßenseite im Auge: seinen Sohn, die Nachbarstochter Maria Di Stasio und deren Bruder Antonio. Sie sammeln Brennholz, neben dem großen Tank am Rande des North End.
Dieses riesige stählerne Monstrum beherrscht Bostons ältestes Viertel, das so dicht besiedelt ist wie kaum ein anderer Ort auf der Welt: 30000 Menschen leben hier auf weniger als einem Quadratkilometer.
Von der daneben liegenden Hochbahn aus gesehen wirkt der Tank, als habe jemand eine riesige Konservendose zwischen die Häuser am Hafen gesetzt, mitten in das städtische North End, Paving Yard, wo Schmiede Pferde beschlagen und Steinmetze Pflastersteine hauen.
Er überragt die Waggons der kleinen Frachtbahn auf der Commercial Street und auch die Feuerwache am Ufer.
Seit drei Jahren steht dieser Tank im North End, oft dringt ein Blubbern und Stöhnen aus seinem Inneren. Ein dunkler Sirup tritt zwischen den rostbraun angemalten Stahlplatten hervor, läuft die Wände herunter und sammelt sich auf dem Boden.
Die zähflüssige Masse bleibt übrig, wenn man Zucker aus Zuckerrohr gewinnt. Bitter schmeckt diese Melasse, leicht metallisch, ein wenig nach Lakritz und nach Kaffee.
Die Nachbarskinder sammeln sie in Eimern für ihre Mütter. Sie kratzen sie mit Stöcken vom Tank und schlecken sie ab. Eine zwar kostenlose, aber streng verbotene Leckerei: Zwischen den Waggons und den Pferdegespannen ist es gefährlich.
Gerade haben Mitarbeiter der Eisenbahn Maria Di Stasio erwischt und schimpfen sie aus. Es ist zwanzig vor eins. Pasquale in seinen roten Pullovern duckt sich hinter den Tank.
Dann geht die Welt unter.
Ein ganzer Stadtteil wird zerstört
Es ertönt ein Geräusch wie Maschinengewehrfeuer, als Tausende Nieten aus den Stahlplatten springen. Wo Pasquale stand, türmt sich kurz eine Wand aus Melasse, drei Stockwerke hoch. Und dann schlagen 12000 Tonnen Sirup Häuser zu Trümmern, schieben die Feuerwache von ihrem Fundament, zerquetschen Autos, als seien sie Spielzeug aus Blech. Die Welle hebt einen vier Tonnen schweren Lastwagen an und spült ihn in den Hafen.
Ein Bruchstück des Tanks zertrümmert die Stütze der Hochbahn. Deren Schienen brechen bis fast auf die Straße hinunter, Sekunden, nachdem der Zug die Stelle überfahren hat. Der Fahrer stoppt, klettert vorsichtig die halb zerstörten Gleise entlang, dann beginnt er zu rennen, zu winken und zu schreien, dem nachfolgenden Zug entgegen: „Die Strecke ist kaputt! Anhalten!“
Mannshoch schlägt die klebrige Flut gegen Backsteinmauern, lässt Fenster bersten, schließt Arbeiter in Werkstätten und Kellern ein.
Es ist eines der bizarrsten Unglücke der Geschichte: Eine harmlose Flüssigkeit, die Bostons Bürger sonst für gebackene Bohnen und für Lebkuchen verwenden, verwandelt einen Teil ihrer Stadt innerhalb von Sekunden in ein Katastrophengebiet.
Die Menschen werden Wochen brauchen, um die Trümmer fortzuräumen, und Jahre warten müssen, um Antworten auf ihre Fragen zu erhalten: Wie konnte das passieren? Wer ist schuld an der Sirupflut?
Die Schuldfrage ist nicht einfach zu klären
Es war eine Investition in den Krieg. Eine große Aktiengesellschaft, United States Industrial Alcohol (USIA), hatte den Tank im Winter des Jahres 1915 bauen lassen. Statt immer wieder kleinere Mengen Melasse von Zwischenhändlern kaufen zu müssen, konnte das Unternehmen fortan seine aus der Karibik kommenden Schiffe am Kai anlegen lassen, den Tank vollpumpen und dann die Melasse nach und nach abtransportieren.
Das senkte Kosten in einer Zeit, in der Sirup zu einem höchst wertvollen Stoff wurde: Aus Melasse lässt sich Industriealkohol destillieren, wichtig für die Herstellung von Explosionsstoffen – etwas, was Europas Armeen 1915 dringend brauchten.
Zwar hielten sich die USA noch aus dem Weltkrieg heraus, doch allein die Nachfrage aus Kanada, Frankreich und Großbritannien nach Sprengmitteln bewahrte Amerikas Wirtschaft vor einer Rezession. USIA galt als vielversprechende Aktie für Menschen, die auf den Krieg spekulierten. Das Unternehmen hat den Tank nicht zufällig im Bostoner North End errichtet, in einem Einwandererviertel. Es hätte andere, ähnlich günstig gelegene Orte am Hafen gegeben. Aber im North End dürfen nur wenige Menschen wählen – sie können kaum mitreden bei dem, was in ihrer Nachbarschaft geschieht.
Vor allem Italiener leben hier: Das Viertel, in das die USIA ihren kriegswichtigen Tank gestellt hat, ist damit auch eine Hochburg der Anarchisten. Seit der Jahrhundertwende haben die Radikalen in den USA immer mehr Zulauf. Einige ihrer prominentesten Anführer sind italienische Exilanten.
Zunächst war der Plan der Aktiengesellschaft aufgegangen. Das Unternehmen hat gut am Krieg verdient und seinen Gewinn allein zwischen den Jahren 1914 und 1916 verneunfacht. Nach dem Waffenstillstand im November 1918 hatte die USIA noch einmal versucht, so viel Gewinn als möglich aus ihrer Investition im Bostoner Hafen zu holen. Im Frieden sollte die Melasse zu Rum werden.
Die Zeit dafür ist knapp: Ein neuer Verfassungszusatz verbietet unter anderem, alkoholische Getränke herzustellen und zu verkaufen. Im Januar 1919 muss ihn nur noch ein Bundesstaat ratifizieren, damit die Prohibition in Kraft tritt. Jeden Tag kann es nun so weit sein. Dann wird es eine Schonfrist von einigen Monaten geben. Die USIA wollte diese Zeit nutzen: Wenige Tage vor dem Unglück hat ein Schiff neuen Sirup gebracht. Als Pasquale Iantosca Brennholz sammeln ging, war der Tank mit fast neun Millionen Litern beinahe bis zum Rand gefüllt.
Dann barst der Stahl, und der Himmel verdunkelte sich.
Die schrecklichen Minuten, Stunden und Tage nach dem Unglück
Als die Welle sich ausgelaufen hat, ist der Bereich knietief mit Sirup bedeckt. Wo der Tank stand, liegt nahezu unversehrt sein Dach.
Pasquale ist verschwunden.
Schnell kommen die Fahrerinnen vom Roten Kreuz, die Wagen der Polizei sowie der Krankenhäuser und der Feuerwehr. Hunderte Helfer schwärmen aus, suchen Überlebende, ziehen Verletzte aus der Flut, bergen Tote. Sie können oft nicht erkennen, ob sich Mensch oder Tier unter der braunen Masse aufbäumt, verzweifelt versucht, Luft zu bekommen, aufzustehen. In der kühlen Januarluft wird der Sirup schnell immer zäher und damit tödlicher.
Unter Fässern ziehen Feuerwehrmänner Maria Di Stasio hervor. Sie legen das tote Mädchen auf eine Bahre und decken es zu. Marias Bruder Antonio überlebt mit gebrochenem Schädel. Schüsse hallen über das Gelände: Polizisten müssen Dutzende Pferde erlösen, die hilflos und verletzt an der Straße kleben. Priester waten in ihren schwarzen Roben durch den Sirup, trösten die Verwundeten, salben die Sterbenden.
Die Opfer werden in die nahen Krankenhäuser gefahren, viele in die kleinere Haymarket Relief Station, die bald hoffnungslos überfüllt ist. Schwestern und Ärzte schneiden ihnen die klebrigen braunen Kleider vom Leib, versuchen, die Masse mit Natron und viel heißem Wasser von den Gesichtern zu waschen, und sehen oft dann erst, ob sie eine Frau oder einen Mann vor sich haben – und wie schwer der Patient verletzt ist.
Bald riecht das Krankenhaus herb-süßlich, lassen sich die Betten nicht mehr schieben, weil ihre Räder verklebt sind. Um die Köpfe der Patienten bilden sich dunkle Ringe auf den weißen Kissen. Am zweiten Tag der Aufräumarbeiten läuten die Kirchenglocken: Nebraska hat die Prohibition ratifiziert. Am sechsten finden die Helfer ein Kind, eingeklemmt zwischen einem Waggon und einer Mauer, 15 Meter vom Tank entfernt. Giuseppe Iantosca identifiziert den zerschmetterten Körper anhand der beiden roten Pullover: Pasquale, sein Sohn.
War es doch ein Anschlag?
Die Besitzer des Tanks beteiligen sich nur zögerlich an den Arbeiten. Ihr Anwalt allerdings gibt bereits am Abend der Katastrophe eine Erklärung ab: „Wir wissen ohne Zweifel, dass der Tank nicht schwach war. Etwas von außen hat ihn zerstört.“
Mit anderen Worten: Jemand hat einen Anschlag verübt.
Und während noch immer Vermisste tot geborgen werden, während Verletzte mit gebrochenen Knochen und eingedrückten Schädeln ihren Wunden erliegen, während Hunderte Helfer Stahl und Holz zerschneiden und abtransportieren, während sie Brackwasser aus dem Bostoner Hafen pumpen, weil es als einziges Mittel gegen die zähe Melasse hilft, während Sirup an Schuhen und Kleidern durch die Stadt getragen wird, bis ganz Boston zu kleben scheint – während all dessen beharrt die USIA darauf, keinen Fehler gemacht zu haben. Das Unternehmen wird für Zehntausende Dollar Experten rekrutieren und ein Modell des Tanks bauen lassen, um das angebliche Verbrechen zu beweisen.
Die Sirupflut hat einen Schaden von mehr als einer Million US-Dollar verursacht, das sind nach heutigem Wert umgerechnet fast 100 Millionen Euro. Sie hat 21 Menschen getötet und 150 verletzt.
Fast zwei Jahre nach der Katastrophe beginnt deshalb der größte Zivilprozess in der Geschichte des Bundesstaats Massachusetts: Insgesamt 119 Einzelklagen gegen die USIA werden zu einer Klage zusammengefasst.
Der USIA-Anwalt ergreift am 2. September 1920 erstmals das Wort. „Es gab eine Treppe zum Dach des Tanks“, sagt er, „es war einfach, dort hinaufzugehen und einen Sprengsatz durch eine der vier Luken zu werfen. Man hätte nicht mehr als fünf Pfund Dynamit gebraucht.“
Die Verteidigungsstrategie der USIA - geht sie auf?
Anarchistische Terroristen haben den Tank in die Luft gejagt, das ist die Verteidigungsstrategie des Unternehmens. Sie ist nicht so weit hergeholt, wie sie klingt. Denn seit Kriegsbeginn haben die Radikalen immer wieder Bombenattentate in den USA verübt, insbesondere auf Munitionsfabriken und Waffenproduzenten, aber auch auf Vertreter des Staates.
Im Dezember 1916 haben sie ein Loch in die Mauer einer Polizeiwache gesprengt, wenige Hundert Meter vom Tank entfernt.
Und noch im Januar 1919 hingen Plakate an den Hauswänden der Commercial Street. „Deportation wird den Sturm nicht von diesen Gestaden abhalten“, stand darauf, „er ist bereits hier und wird euch sehr bald zermalmen und vernichten in Blut und Feuer.“ Und: „Wir werden euch in die Luft sprengen.“
Die Warnung erschien nur wenige Tage vor der Katastrophe.
Seitdem haben Bomben unter anderem die Häuser eines Richters in Boston und des Generalstaatsanwalts in Washington, D.C. zerstört, fast 40 Menschen in der New Yorker Wall Street getötet. Seitdem sind die Anarchisten Nicola Sacco und Bartolomeo Vanzetti wegen Mordes angeklagt worden. Zudem haben amerikanische Gerichte in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts meistens zugunsten von Unternehmen geurteilt – selbst nach einem tödlichen Brand in New York, bei dem 1911 fast 150 Menschen gestorben waren, weil die Fabrikbesitzer die Türen verschlossen hatten.
Allerdings hat die Theorie des Anwalts der USIA einige entscheidende Schwachstellen: Niemand hat am Mittag des 15. Januar einen Menschen auf der Treppe des Tanks gesehen oder jemanden dabei beobachtet, etwas in die Luke zu werfen. Ein Experte muss im Kreuzverhör außerdem zugeben, dass bei einer Explosion Fensterscheiben vom Luftdruck zersprungen wären – und das ist bei aller Zerstörung an diesem Tag nicht passiert.
Baumängel, Kapitalismus und ein wichtiges Urteil
Fünf Jahre dauert der Prozess, 920 Zeugen treten auf, die Akten umfassen 25000 Seiten. Schon bald fügen sie sich zu einer anderen Geschichte. Einer Geschichte, die nichts zu tun hat mit bombenbauenden Anarchisten – und stattdessen alles mit ebenso skrupellosen Kapitalisten.
Die Arbeiter haben den Tank im Winter 1915 innerhalb von nicht einmal zwei Monaten hochgezogen, überwacht vom Finanzleiter der zuständigen Tochterfirma. Die Chefs der USIA hatten ihm eine Vizepräsidentschaft im New Yorker Mutterunternehmen in Aussicht gestellt, wenn er sich in Boston bewähren sollte.
Er gibt vor Gericht zu, keine Baupläne lesen zu können. Keine Ahnung zu haben von Druck pro Quadratzoll, von Sicherheitsfaktoren. Er hatte nicht gemerkt, dass die Stahlplatten dünner waren als bestellt – und heutigen Sachverständigen zufolge sogar nur halb so dick wie nötig. Er hatte keinen Spezialisten hinzugezogen.
Und statt den Tank vor der ersten Melasse-Lieferung mit Wasser zu füllen, wie es vorgeschrieben gewesen wä-re, hatte er nicht mehr als 15 Zentimeter hineinlaufen lassen. Warum? Um Geld und Zeit zu sparen, sagt er.
Der Finanzleiter ignorierte alle Warnungen von Anwohnern und Mitarbeitern über das Blubbern und Stöhnen, über die Lecks zwischen den Nieten und den Rost im Inneren.
Doch das Versagen, das sich vor Gericht offenbart, geht über das einzelne Unternehmen und seine Angestellten hinaus. Niemand überprüfte, ob dieser monströse Tank in einem Wohngebiet den Vorschriften entsprach: Die Baubehörde hatte ihn als „Gefäß“ behandelt, nicht als Gebäude – und sich lediglich den Plan für den Betonsockel vorlegen lassen.
„Achtlosigkeit gegenüber menschlichem Leben“ nennt dies der Anwalt der Opfer: „Dieser Tank, im Herzen einer großen Stadt, wurde gebaut, betrieben und unterhalten, ohne jemals einen einzigen Ratschlag irgendeiner kompetenten Stelle einzuholen.“
Am 28. April 1925, mehr als sechs Jahre nach der Katastrophe, ergeht das Urteil: Die USIA muss 300000 Dollar Schadenersatz zahlen – eine Summe, die das Unternehmen in einer außergerichtlichen Einigung mehr als verdoppelt, um einem weiteren Prozess zu entgehen.
Für den Tod von Pasquale Iantosca erhält sein Vater Giuseppe einige Tausend Dollar. Weniger als andere, weil das Kind sofort tot gewesen sei und nicht gelitten habe. Es ist trotzdem ein erstaunliches Urteil in einer Zeit, in der Unternehmer daran gewöhnt sind, von jeglicher Schuld freigesprochen zu werden. Die USIA muss erkennen, dass sich das Verhältnis zwischen Öffentlichkeit und Industrie verändert.
Die Sirupflut - Wegweiser für die heutige Industrie
Am Beginn des Jahrhunderts hatten noch Verheißungen dieses Verhältnis geprägt, waren Autos von den ersten automatischen Fließbändern gerollt, und im Weltkrieg schienen die Verdienstchancen schier grenzenlos.
Doch in den Jahren nach der Melasseflut begreifen die Bürger der USA, dass Steuern und Arbeitsplätze nicht alles sind, was sie von ihren Unternehmen erwarten dürfen, sie fordern und erhalten Gesetze, um die Industrie zu kontrollieren.
So verändert die Katastrophe von Boston, wie in den USA gebaut wird. Künftig muss ein Ingenieur große Anlagen abnehmen, bevor sie genehmigt werden. Und sie trägt dazu bei, dass sich in den Jahren nach dem Prozess immer mehr italienische Einwanderer einbürgern lassen.
Sie wollen in der Lage sein, sich zu wehren, wenn wieder jemand den Tod in ihre Mitte stellt.