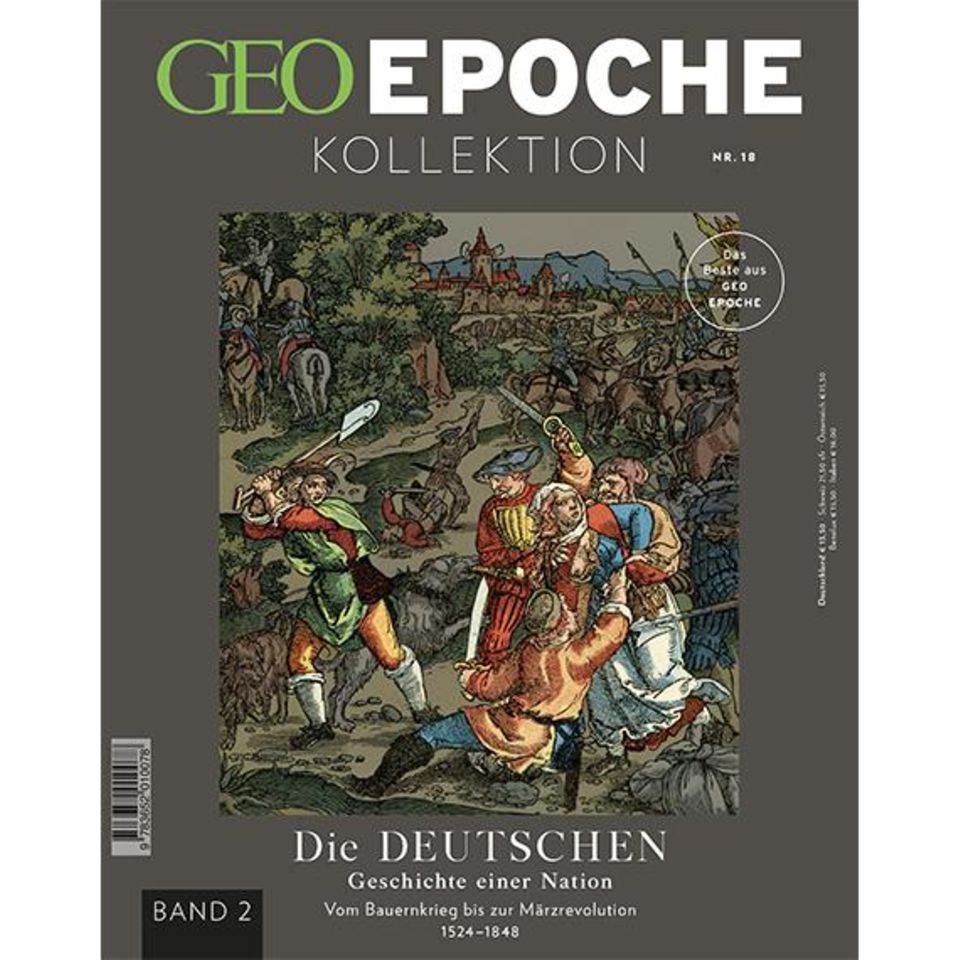Dass so viele kommen würden! Staunend blickt der Anwalt und Journalist Johann Georg August Wirth am Vormittag des 27. Mai 1832 auf die Menge vor der Hambacher Schlossruine. Überall blitzen schwarz-rot-goldene Kokarden. Ganz vorn eine große Fahne mit den Worten: „Deutschlands Wiedergeburt“.
Seit acht Uhr strömen Menschen zur Schlossruine herauf: Kaufleute, Handwerker, Ärzte, Juristen, Studenten, aber auch Winzer, Kleinbauern, Gesellen sowie – und das ist neu – Frauen. Im Aufruf zu dem Fest hatten die Organisatoren ausdrücklich darauf hingewiesen, dass deren „politische Missachtung in der europäischen Ordnung“ ein Fehler sei.
Gemeinsam mit dem Publizisten Philipp Jakob Siebenpfeiffer hat Wirth auf Flugblättern und in Zeitungen die Hauptforderungen der Reformwilligen formuliert: nationale Einheit in einem deutschen Verfassungsstaat, mit Presse-, Meinungs-, Versammlungs- und Handelsfreiheit, eingebunden in ein republikanisches Europa. Diese Ziele sollen heute öffentlich verkündet werden.
Sehnsucht nach Nationalstaat mit liberaler Verfassung wächst
Mehr als 20000 Menschen stehen auf dem Schlossberg von Hambach bei Neustadt. Damit ist das „Hambacher Fest“ die größte politische Versammlung, die es in Deutschland je gegeben hat. Es zeigt, dass sich die Sehnsucht nach einem Nationalstaat mit liberaler Verfassung immer weiter in der Bevölkerung verbreitet – über das Bürgertum hinaus. Seit 1819 unterbinden die Herrscher jede kritische Regung mit Zensur, ächten die Verbreitung aufrührerischen Schriftguts. Daher weichen die Aktivisten in das gesellschaftliche Leben aus, treffen sich auf Festen, gründen Vereine.
1830 kommt es zu einer Wirtschaftskrise: Die Brotpreise steigen, die Händler leiden unter Zöllen zwischen den Einzelstaaten. Missernten verschlimmern Armut und Elend. Zur gleichen Zeit rütteln mehrere Ereignisse die unzufriedene Bevölkerung und die liberalen Bürger auf: Im Juli vertreibt in Paris das Volk den selbstherrlichen König Karl X. Und im Herbst führen Aufständische in Brüssel die Belgier in die Unabhängigkeit. Wenige Wochen später erheben sich die Polen gegen ihre russischen Herrscher.
An vielen Orten in Deutschland sammeln national gesinnte Bürger Geld und Verbandszeug für die Rebellen im Osten. Als der Aufstand ein Jahr später scheitert und polnische Freiheitskämpfer auf dem Weg ins französische Exil durch deutsche Gebiete ziehen, werden sie begeistert gefeiert.
Ermutigt vor allem durch das Pariser Vorbild, begehren ab 1830 in deutschen Staaten die Untertanen auf und setzen etwa in Braunschweig und Kurhessen Verfassungen durch.
Nicht überall unterdrücken die Herrschenden kritische Regungen. Im Südwesten wirkt das Erbe der napoleonischen Zeit nach, das den Menschen ein liberaleres Justizsystem zugesteht. So auch im „Rheinkreis“, einem Territorium, das erst seit 1816 zum Königreich Bayern gehört. In dieser Region, in der auch der Weinort Neustadt liegt, dürfen sich die Menschen unter gewissen Bedingungen frei versammeln, können Zeitungen und eigene Schriften herausgeben.
Und so verbreiten hier viele Liberale ihren Protest gegen Willkür, soziales Elend, das Steuer- und Zollsystem. Auch Wirth zieht mit seinem Blatt „Deutsche Tribüne“ hierher, greift in Artikeln die Zensur an. Er lernt Siebenpfeiffer kennen, der ebenfalls eine Zeitung herausbringt, die sich für einen deutschen Nationalstaat und eine Verfassung des „Gesamtvaterlandes“ einsetzt.
Doch nach der Pariser Revolution von 1830 wächst auch im Rheinkreis der Druck. Die Behörden versuchen, oppositionelle Journalisten einzuschüchtern, beschlagnahmen Zeitungen, versiegeln Druckpressen, verhaften Redakteure.
Daraufhin organisieren sich Ende Januar 1832 die bedrängten Publizisten, darunter Wirth und Siebenpfeiffer, gründen den „Deutschen Vaterlandsverein zur Unterstützung der freien Presse“, bald „Preß- und Vaterlandsverein“ genannt.
Rasch wächst der Bund auf mehr als 5000 Mitglieder an. Er unterstützt von der Obrigkeit drangsalierte Blätter, gibt eigene Flugschriften heraus, veranstaltet Treffen, auf denen die Teilnehmer diskutieren und politische Reden bejubeln.
Mitte April buchen Mitglieder des im Monat zuvor bereits wieder verbotenen Vereins in der „Neuen Speyerer Zeitung“ eine Anzeige, in der sie zu einem großen Volksfest am 27. Mai an der Hambacher Schlossruine aufrufen.
Doch der oberste Beamte des Rheinkreises verbietet die Veranstaltung. Erst als empörte Bürger ein Gutachten veröffentlichen mit dem Nachweis, dass das Verbot den Versammlungsrechten widerspricht, muss er die Feier zulassen.
Wirth und Siebenpfeiffer werden verhaftet und angeklagt
Gegen Mittag beginnt auf einer hölzernen Bühne die Kundgebung. Siebenpfeiffer ruft den Versammelten zu: „Vaterland – Freiheit – ja! Ein freies deutsches Vaterland – dies ist der Sinn des heutigen Festes!“ Und Wirth beschwört die Festteilnehmer, die freie Presse zu unterstützen, da die „Allmacht der öffentlichen Meinung“ Deutschland zu Freiheit und Frieden verhelfen werde.
Weiter hinten steht das Publikum in Gruppen zusammen und lässt sich von Boten aus den ersten Reihen berichten, was vorn deklamiert wird. Am Abend ziehen die Menschen zurück nach Neustadt. „Die ganze Nacht wurde geschossen, gefressen, gesoffen und jubiliert“, berichtet später ein Augenzeuge. Viele Teilnehmer nehmen an den langwierigen politischen Debatten der nächsten Tage teil – das Fest endet erst am 1. Juni.
Einen gemeinsamen Schlussappell aber gibt es nicht. Auch die Frage, ob man tatsächlich einen Umsturz wagen oder langsam und demokratisch vorgehen solle, bleibt offen: Zu unsicher sind sich die Versammelten, ob sie im Namen aller Deutschen handeln dürfen.
Aber sie tragen ihre Begeisterung für Nation und Freiheit in die Regionen zurück. Schon begehren hungrige Städter in Worms und Frankenthal auf und plündern Getreidemagazine. Zu einer breiten Revolte kommt es jedoch nicht.
Hambacher Fest bleibt nicht ohne Wirkung
Die bayerische Regierung reagiert: Bis zum 24. Juni 1832 rücken 8500 Mann in den Rheinkreis ein. Wirth und Siebenpfeiffer werden verhaftet und zusammen mit mehreren Mitstreitern wegen „versuchter Aufreizung zum Sturz der Staatsregierung“ angeklagt. Trotz sensationeller Freisprüche erreicht die bayerische Justiz kurz darauf Verurteilungen zu jeweils zwei Jahren Haft wegen Beamtenbeleidigung und ähnlicher Vergehen. Siebenpfeiffer flieht nach dem Urteil in die Schweiz, Wirth sitzt seine Strafe in Kaiserslautern ab.
Auch der Bundestag in Frankfurt geht nun auf Druck Preußens und Österreichs entschieden gegen die liberale Bewegung vor: Die Zensur wird nochmals deutlich verschärft, politische Versammlungen und Vereine verboten.
Das Fest von Hambach bleibt dennoch nicht ohne Wirkung. Es ist ein Fanal, ein Kristallisationspunkt und Verstärker des weiter wachsenden Unmuts. Am 3. April 1833 können Soldaten in Frankfurt gerade noch verhindern, dass radikale Studenten Bundesgebäude besetzen und – so ihr Plan – die Republik ausrufen.
Noch schaffen es Richter, Gendarmen und Soldaten, das Aufbegehren der national gesinnten Reformer sowie des unzufriedenen Volkes zu unterdrücken.
Bis zum März 1848.