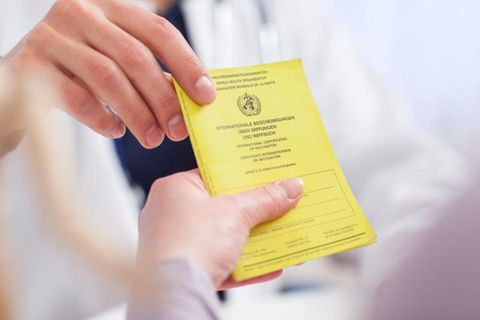Mehr als 100000 Ärzte in Deutschland behandeln Rückenleiden, darunter Allgemeinmediziner, Orthopäden, Neurologen und Chirurgen. Doch wie findet ein Betroffener den für ihn geeigneten?
Entscheidend ist zweifellos die Fachkompetenz des Mediziners. Große Bedeutung messen Patienten aber auch Freundlichkeit und Einfühlungsvermögen des Arztes zu – sowie der Frage, wie viel Zeit er sich für die Behandlung nimmt (so eine Auswertung von 3000 deutschen Patientenkommentaren).
Vor allem die Kompetenz von Ärzten lässt sich nur schwer beurteilen. Doch der Patient hat verschiedene Möglichkeiten, sich zu informieren:
- beim Hausarzt;
- durch Bewertungsportale;
- anhand von Klinik-Spezialisierungen
I. Beim Hausarzt
Der erste Weg bei Rückenschmerzen führt gewöhnlich zum Hausarzt. Der sollte eine Diagnose nach bestimmten Kriterien stellen und nicht zu rasch Röntgenaufnahmen und Computerto- mografien veranlassen (siehe Seite 38). Kann er nicht helfen, empfiehlt er einen Fachkollegen.
Meist wird dies ein Arzt sein, mit dem er gute Erfahrungen gemacht hat. Doch erfolgen Empfehlungen unter Ärzten manchmal auch über inoffizielle Abmachungen; teilweise zahlen Fachmediziner sogar Prämien an Hausärzte. Daher sollte man stets nachfragen, aus welchen Gründen der Hausarzt einen speziellen Kollegen empfiehlt.
II. Durch Bewertungsportale im Internet
In Deutschland gibt es mindestens ein Dutzend medizinische Such- und Bewertungsportale, zu den bekanntesten zählen „Jameda“ und die „Weisse Liste“. Sie funktionieren nach einem einfachen Prinzip: Anhand der eigenen Postleitzahl und der gesuchten Fachrichtung lassen sich in den Datenbanken Mediziner in der nahen Umgebung auffinden.
Außerdem haben Patienten die Möglichkeit, Ärzte zu bewerten, bei denen sie in Behandlung sind oder waren. Dazu füllen sie online Fragebögen aus, darüber hinaus können sie in der Regel noch freie Kommentare verfassen. Das Angebot von Jameda nutzen nach eigenen Angaben monatlich sechs Millionen Patienten.
Doch die Urteile über die Ärzte sind nur begrenzt aussagekräftig, weil die Patienten in der Regel über wenig medizinischen Sachverstand verfügen. Da zudem vor allem jene Patienten ihren Arzt beurteilen, die entweder begeistert sind oder aber sehr enttäuscht, gibt es auf den Portalen nur wenig ausgewogene Bewertungen.
Zudem sind die Internetportale nicht vor Manipulation geschützt – auch wenn die Betreiber darauf verweisen, dass sie versuchen, Eigen- und Gefälligkeitsbewertungen oder unangemessene Schmähungen zu löschen.
Video-Tipp: Yoga für den Rücken

Für zusätzliche Vorbehalte sorgt allerdings, dass einige Portale Ärzten gegen monatliche Beträge spezielle Leistungen gewähren, etwa eine besonders ansprechende und ausführliche Präsentation. Bei Jameda ging die Bevorteilung der zahlenden Kunden so weit, dass der Bundesgerichtshof im Februar 2018 dem Betreiber seinen Status als „neutraler Informationsvermittler“ aberkannte. Daraufhin wurde die im Urteil bemängelte Praktik zurückgezogen – das Geschäftsmodell mit kostenpflichtigen „Premium-Paketen“ besteht jedoch weiter.
Es empfiehlt sich daher, mehrere Portale zu vergleichen und auch nichtkommerzielle Angebote einzubeziehen wie die Weisse Liste oder den „vdek- Arztlotsen“, eine Kooperation des Verbandes der Ersatzkassen mit der Stiftung Gesundheit. Eine große Zahl positiver Rückmeldungen erhöht dann zumindest die Chance, auf einen freundlichen und patientenorientierten Arzt zu treffen.
Bei Krankenhäusern sind indivi- duelle Bewertungen einzelner Ärzte ohne- hin weniger sinnvoll: Denn von wem ein Patient etwa operiert wird, von einem erfahrenen Arzt oder einem Jungmediziner, lässt sich vorher kaum festlegen.
Um Betroffenen bei der Suche nach einer Klinik zu helfen, greift die Weisse Liste daher auf jene Qualitätsberichte zurück, die fast alle Krankenhäuser in Deutschland aufgrund gesetzlicher Verpflichtung erstellen müssen.
Darin sind zahlreiche Daten aufgelistet, die allerdings leicht falsch gedeutet werden können: So muss etwa bei der Bewertung einer Klinik unbedingt beachtet werden, ob in diesem Krankenhaus vorwiegend leichtere Fälle oder aber viele komplizierte und schwere Fälle behandelt werden – was die Erfolgsquote von Operationen nach unten drückt, selbst wenn die Mediziner exzellente Arbeit leisten.
Die Weisse Liste verzichtet auf solche Statistiken, gibt aber (neben allgemeinen Informationen) für jeden Behandlungsanlass die Fallzahlen an.
Nach Einschätzung von Joachim Szecsenyi, dem Geschäftsführer des AQUA-Instituts für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen, ist auch bei der Interpretation dieser Ergebnisse Vorsicht geboten: Denn eine hohe Fallzahl allein sagt noch nichts über eine gute Behandlung aus. „Entscheidend ist, ob auch die Indikation richtig gestellt wurde – das heißt, ob der Eingriff auch medizinisch angemessen war.“
Zusätzlich werden daher bei der Weissen Liste auch Befragungen von Betroffenen mit einbezogen: Dazu werden zufällig ausgewählte Patienten nach ihrem Krankenhausaufenthalt angeschrieben und unter anderem darüber befragt, welchen Eindruck sie von der Qualität der Versorgung hatten. Auch sollen sie beurteilen, wie das Informationsverhalten von Ärzten und Pflegekräften war und wie sie die Sauberkeit im Krankenhaus einschätzen.
III. Anhand von Spezialisierungen der Krankenhäuser
Grundsätzlich gilt: In einem Universitätsklinikum werden eher komplizierte, seltene Fälle operiert, in einem Kreiskrankenhaus vermehrt häufig auftretende Leiden. Doch inzwischen spezialisieren sich immer mehr kleinere Kliniken auf bestimmte Eingriffe, bei denen sie dann gute Erfolge vorweisen können.
Und grundsätzlich ist es bei Ärzten so wie bei Handwerkern: Je mehr Übung sie haben, desto weniger Fehler unterlaufen ihnen. Wie häufig in den vergangenen Jahren ein bestimmter Eingriff vorgenommen wurde, sagt daher etwas über die Erfahrung der Klinik mit einer solchen Operation aus.
Patienten sollten bei alldem jedoch hinterfragen, ob ein Eingriff auch tatsächlich medizinisch notwendig ist, so Joachim Szecsenyi vom AQUA-Institut. Denn insbesondere bei Rückenoperationen gebe es Anhaltspunkte dafür, dass das derzeit herrschende Vergütungssystem durch Fallpauschalen zu unnötigen Eingriffen verführt.
„Vor einer Rücken-OP sollte man sich – von Notfällen abgesehen – immer eine zweite Meinung einholen“, rät Szecsenyi. Über die Kosten einer zusätzlichen Konsultation müssen sich Patienten meist keine Gedanken machen: Sie werden von den Krankenkassen getragen.
Ein gut informierter Patient profitiert zweifach
Alle diese Anhaltspunkte zusammengenommen – Empfehlungen des Hausarztes, Bewertungsportale und Spezialisierungen – können ein ungefähres Bild der Kompetenz von Medizinern und deren Behandlungsansätzen vermitteln.
Zusätzliche Hilfe bietet auch die Website patienten-information.de des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medizin: Dort finden sich unter anderem eine Checkliste „Woran erkennt man eine gute Arztpraxis?“ sowie Links zu Patientenleitlinien und weiteren seriösen Informationsquellen.
Letztlich profitiert ein gut informierter Patient gleich zweifach: Er kann sich besser als andere mit seinem Arzt austauschen, ihn verstehen und einschätzen. Und er kann zu Medizinern und Therapien eher Vertrauen fassen – und Vertrauen, so zeigen die Erkenntnisse etwa von Neurobiologen, regt die Kräfte der Selbstheilung an.