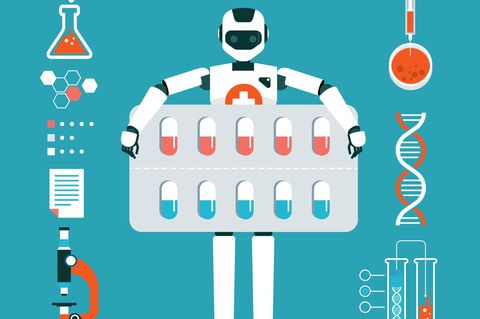GEO plus
Jetzt testen
Weiterlesen mit GEO+
4 Wochen für 1 €. Jederzeit kündbar.
Bereits registriert?