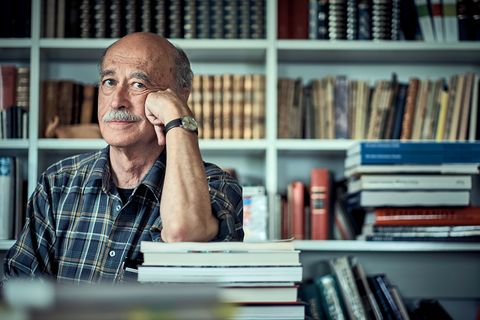Irgendwann in der pubertären Entwicklung von Kindern müssen deren Eltern mit einer tiefgreifenden Veränderung ihres Nachwuchses umzugehen lernen, die Mütter wie Väter oft wie ins Herz trifft: Jahrelang waren sie für ihren Sohn oder die Tochter der erste Ansprechpartner, der wichtigste Begleiter durch Freude und Leid.
Doch plötzlich scheinen die Kinder das Interesse an ihnen zu verlieren: Viel lieber als mit der Mutter trifft sich die 13-jährige Tochter nun mit ihrer Clique zum Stadtbummel. Und der 14-jährige Sohn will beim Wochenendausflug der Familie ans Meer lieber zu Hause bleiben – und mit seinen Freunden vor dem Computer hocken.
Väter und Mütter müssen ihre Sonderstellung im Leben der Kinder abgeben. In der Pubertät werden für die Teenager stattdessen Gleichaltrige besonders wichtig – die Freunde, die Mitglieder der Clique, kurz: die „Peergroup“, wie Wissenschaftler die Altersgenossen nennen (von engl. peer, Gleichgestellter).
Freunde und Schulkameraden erziehen sich gegenseitig
Die Peergroup bestimmt über Freizeitgestaltung, Kleidungsstil, Musikvorlieben – und zieht alle Aufmerksamkeit auf sich: Über digitale Medien stehen die Heranwachsenden inzwischen fast rund um die Uhr miteinander in Kontakt. Nur so wissen sie, was anliegt und was nicht, mit wem man sich trifft, welches Treffen nicht verpasst werden darf.
Auch Nähe und Vertrautheit suchen die Heranwachsenden nun weniger in der Familie, sondern eher unter ihresgleichen. Mit einem Mal geht es ihnen vor allem darum, wer zu welcher Gruppe gehört, wer mit wem befreundet ist, was man gemeinsam erlebt.
Viele Eltern meinen, die Pubertierenden verschwendeten ihre Zeit, hätten nichts Besseres im Sinn, als ohne Ziel in der Stadt umherzulaufen, ständig nutzlose Nachrichten zu verschicken, tatenlos gemeinsam abzuhängen.
Tatsächlich aber übernehmen die Gleichaltrigen in der Gruppe eine ungemein wichtige Funktion für jeden Einzelnen. Zum einen bieten sie Unterstützung und Orientierung, zum anderen stoßen sie etliche Entwicklungsprozesse an, die wichtig sind, um in der Welt der Erwachsenen bestehen zu können. Freunde, Schulkameraden und die Mitspieler aus dem Sportverein erziehen sich gewissermaßen gegenseitig, lernen voneinander – und bereiten sich so auf zukünftige Herausforderungen in der Gesellschaft vor.
Müttern und Vätern bleiben diese Entwicklungen nicht selten verborgen, sie machen sich dann Sorgen, fragen sich: Verleiten die Freunde den eigenen Spross dazu, mit dem Rauchen zu beginnen, viel Alkohol zu trinken, gar Drogen zu nehmen oder die Schule zu vernachlässigen? Könnte die Tochter auf die Idee kommen, sich ein Tattoo stechen zu lassen, nur weil die anderen in ihrer Clique auch tätowiert sind? Lässt sich der Sohn dazu anstacheln, einen Kiosk aufzubrechen oder im Fußballstadion gegnerische Fans anzupöbeln? Oder besteht umgekehrt die Gefahr, dass das eigene Kind in der Schulklasse an den Rand gedrängt und zum Opfer von Mobbing wird?
Seit vielen Jahren untersuchen Entwicklungspsychologen, wie begründet derartige Ängste sind. Und immer besser gelingt es den Experten zu ermessen, wie sich Jugendliche gegenseitig stärken, wann sie sich schaden und ob es manchmal angebracht ist, dass Eltern zum Wohle ihrer Kinder einschreiten, ihre Vormacht in Erziehungsfragen zurückerlangen.

Denn gerade in jüngerer Zeit hat die Forschung gezeigt: Der Einfluss von Müttern und Vätern mag während der Pubertät schwinden, doch völlig abdanken – wie manche Forscher es noch vor einigen Jahren beschrieben haben – müssen Eltern in dieser Lebensphase keineswegs.
Dass die Peergroup für Teenager so attraktiv erscheint, liegt auch an einem grundlegenden Wandel der Freundschaftsbeziehungen zu Beginn der Pubertät. Jüngere Kinder treffen sich meist mit Freunden gleichen Geschlechts: Mädchen mit Mädchen, Jungen mit Jungen. Zudem empfinden sie ihre Freunde weniger als Gefährten, weniger als Leidensgenossen und Seelenverwandte denn als Spielkameraden. Die Beziehungen sind noch recht eindimensional – und in gewisser Weise austauschbar.
Jugendliche dagegen entwickeln viel engere Bande zueinander, sie empfinden Freundschaften als weit vielschichtiger, bedeutungsvoller. Immer stärker geht es darum, zu erfahren, wer der andere ist, dessen Gedanken und Gefühle nachzuvollziehen, die Sicht des anderen auf das Leben zu begreifen, auf die Welt, auf die Familie. Vom anderen zu lernen, ihn zu verstehen, von ihm verstanden zu werden.
Freundschaften bauen nun mehr und mehr darauf, dass man gemeinsam Erfahrungen sammelt, sich austauscht, Sorgen und Nöte teilt, sich Geheimnisse anvertraut – und Antworten zu finden versucht auf die Fragen, die das Erwachsenwerden mit sich bringt: Wie weit gehe ich, um meine Interessen gegenüber Eltern, Lehrern, Gleichaltrigen durchzusetzen? Wie gehe ich mit Kritik um? Welches Bild haben andere von mir, und welches Bild sollen andere von mir haben?
Die Peergroup ist auch eine Interessengemeinschaft
Fast 80 Prozent der Teenager vertrauen auf die Unterstützung eines bestimmten Freundes oder einer Freundin, wenn sie vor einem Problem stehen und Rat suchen. Sie erkennen, wie wertvoll es ist, einen Gleichaltrigen an seiner Seite zu wissen. Freundschaften in der Pubertät sind daher stabiler als bei Kindern. Die Clique ist wie eine neue Familie; sie wird für viele Teenager zum Zentrum des sozialen Lebens, gewissermaßen eine zweite Heimat.
Die Peergroup ist aber auch eine Interessengemeinschaft, denn die Mitglieder einer Clique – so haben Studien ergeben – kommen nicht zufällig zusammen. Vielmehr stoßen, unbewusst, Teenager mit ähnlichen Interessen aufeinander, mit ähnlichem Temperament, aus der gleichen sozialen Schicht.
Ihre Gemeinschaft fußt, wie Psychologen sagen, auf einem „Selektionseffekt“: Ist einer streitlustig, findet er eher Anschluss bei anderen Provokateuren. Und aufgeschlossene, hilfsbereite Teenager suchen sich eher Gleichaltrige, die ebenfalls sozial veranlagt sind.
Daher haben viele Cliquen bei anderen Jugendlichen einen bestimmten Ruf, gelten etwa als „die Chaoten“, „die Nerds“, „die Ökos“, „die Gamer“ oder „die Mädchen, die sich nur für Klamotten, Jungs und Party interessieren“.
Im Freundeskreis erleben Jungen und Mädchen häufig eine Situation, die zwischen Eltern und Kind so nicht möglich ist: auf Augenhöhe mit anderen zu stehen, seine Meinung zu vertreten, ohne dass ein Erwachsener schließlich ein unumstößliches Machtwort spricht und sagt, was zu tun und was zu lassen ist: Während das Verhältnis zu Eltern und Lehrern von einem Machtgefälle geprägt ist, sind die Beziehungen in der Clique mehr oder minder symmetrisch.
Natürlich gibt es in jeder Gruppe welche, die beliebter, angesehener sind als andere. Und doch können die Jugendlichen im Kreis der Gleichaltrigen, der Gleichberechtigten, lernen, eine neue Form der Selbstbestimmtheit zu entwickeln – jene Souveränität, die jeder Erwachsene benötigt, um selbstbewusst seinen Standpunkt zu verteidigen.
Im Umgang mit der Peergroup erfahren Mädchen und Jungen, dass andere ähnliche Ansprüche stellen wie sie selbst, dass andere die gleichen Rechte fordern – aber auch, dass andere ebenfalls nicht immer ihren Willen durchsetzen können und bereit sind, Nachteile in Kauf zu nehmen, etwa um Streit in der Gruppe zu verhindern. Immer klarer wird den Teens so, dass ihre Sicht der Dinge nicht die einzige ist. Der kindlich eindimensionale Blick auf die Welt weitet sich.
Auch in anderer Hinsicht wirkt sich der Freundeskreis in der Pubertät entscheidend auf das spätere Erwachsenenleben aus: Das Gefühl der Verbundenheit hat eine enorm wichtige Funktion für die seelische Entwicklung.
Es stärkt die psychische Konstitution, wappnet Teenager auch Jahre später noch vor negativen Erfahrungen. Wer in der Pubertät viel Zeit mit Freunden verbracht hat, so wiesen US-Forscher nach, reagiert als junger Erwachsener weniger empfindlich, wenn er von anderen zurückgewiesen wird.
Ablehnung verkraften diese Menschen vermutlich deshalb besser, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass sie sich in schwierigen Situationen auf den Beistand enger Freunde verlassen können. Heranwachsende, die es dagegen nicht schaffen, enge Bande im Jugendalter zu knüpfen, leiden oft unter mangelndem Selbstwert – und sind auch im Erwachsenenalter anfälliger für depressive Stimmungen.
Vor allem aber findet unter den Gleichaltrigen ein Sozialisationsprozess statt, bei dem soziale Normen verinnerlicht werden. Indem Teenager ihre Erlebnisse und Einsichten mit Freunden teilen, diskutieren und gegeneinander abwägen, verinnerlichen sie nach und nach gesellschaftliche Denk- und Gefühlsmuster, also all das, was hierzulande an Werten und Einstellungen verbreitet ist und geachtet wird.
Mädchen etwa entwickeln im Austausch mit anderen ein Gespür dafür, was es heißt, eine Frau zu sein. Jungen erfahren, was Männlichkeit ausmacht – unter anderem dadurch, dass sie sich ständig mit den Altersgenossen vergleichen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten finden, reift mehr und mehr ihre eigene Identität heran.

Auf diese Weise machen sie sich immer klarer, wer sie sein möchten, was ihnen wichtig ist, welche Ziele sie haben, was zu ihrer Persönlichkeit gehört.
Und sie eignen sich zunehmend eine Haltung zu den vielen neuen Erfahrungen und Herausforderungen an, die das pubertäre und später das erwachsene Leben bereithält: Was erwarte ich von einer Liebesbeziehung? Wie wichtig ist Disziplin? Was im Leben möchte ich erreichen? Wie gehe ich damit um, wenn ich verlassen werde?
Zugleich lernen sie die Regeln der Erwachsenenwelt kennen, üben sich darin, zu kooperieren, Konflikte zu lösen, zu argumentieren, Kompromisse zu finden oder Kritik zu ertragen – allesamt soziale Kompetenzen, die auch im späteren Arbeitsleben wichtig sind.
Zu einem erheblichen Teil wird die reifende Persönlichkeit überdies inzwischen auch über digitale Medien geprägt. Schließlich verbringen Jugendliche nicht selten mehrere Stunden am Tag damit, Kontakte in sozialen Netzwerken zu pflegen, Feedback zu geben, Feedback zu bekommen: Sobald sie ein neues Statusfoto hochladen, ein Musikvideo posten, ein paar Zeilen schreiben, sendet ihnen ihre Peergroup Kommentare.
All das ist ein ständiges Bewerten und Experimentieren – ein Testen verschiedener Rollen und verschiedener Lebensstile. Nicht wenige Pubertierende wechseln (in einem für Erwachsene schwer nachvollziehbaren Tempo) ihr Äußeres, oder sie verkünden in den Foren beispielsweise, sich fortan nur noch vegan zu ernähren, um schon eine Woche später die eigenen Vorsätze wieder zu verwerfen.
Damit entwerfen sie, ganz unbewusst, auch in der digitalen Welt unterschiedliche Identitäten, testen verschiedene Versionen eines zukünftigen Ichs. Probieren aus, welche Persönlichkeit zu ihnen passt – und wie die von anderen wahrgenommen wird.
Dass die Teenagerin der Flut digitaler Nachrichten vereinsamen und ihnen der Wert echter Freundschaften abhandenkommt, müssen Eltern in der Regel nicht befürchten. Untersuchungen zeigen: Über Smartphone und Computer pflegen die meisten Jugendlichen vor allem Kontakte, die auch in der realen Welt bestehen, meistens zu den Gleichaltrigen aus der Clique. WhatsApp, Instagram und Co. scheinen soziale Beziehungen also nicht zu ersetzen, sondern die Verbundenheit unter Teenagern eher noch zu stärken.
Von der Peergroup kann auch Gefahr ausgehen
Hinzu kommt: Da die digitalen Medien nahezu ständig verfügbar sind, entstehen im Leben der jungen Menschen neue Rückzugsorte, an denen sie abseits der Erwachsenenwelt untereinander in Kontakt treten können.
Nicht zuletzt bietet der Freundeskreis für viele auch die Gelegenheit, die wohl größte Hürde der Pubertät zu nehmen: die Annäherung an das andere Geschlecht.
Denn oft finden Jugendliche ihren ersten festen Freund oder ihre erste feste Freundin innerhalb dieser Gruppe. Die vertraute Atmosphäre mindert die Hemmschwelle und erleichtert es, jugendliche Scham zu überwinden – letztlich also Intimität zu erleben, die Welt der Sexualität: und damit Erfahrungen zu machen, die kaum ein Jugendlicher seinen Eltern anvertrauen möchte. Dies ist ein Bereich der Identität, der sich zu großen Teilen im Kreis der Peergroup formt.
Obwohl vielen Eltern bewusst ist, wie wichtig der Einfluss der Gleichaltrigen auf die Entwicklung ihrer Kinder ist, befürchten viele Mütter und Väter dennoch, dass ihre Töchter oder ihr Sohn durch die Clique auf Abwege geraten könnten. Und völlig unbegründet sind diese Ängste nicht.
Denn von der Peergroup kann auch Gefahr ausgehen – etwa wenn ein Jugendlicher den Ansprüchen der anderen nicht genügt, weil er vielleicht noch keine sexuellen Erfahrungen gesammelt hat oder er sich die topmodische Kleidung nicht leisten kann. Mindestens jeder zehnte Jugendliche kennt das Gefühl, von den Mitgliedern seiner Clique ausgegrenzt zu werden, nicht die gleiche Anerkennung zu erfahren, vielleicht gar schikaniert zu werden.
Mitunter geraten Betroffene geradezu in einen Teufelskreis. Denn sie sind emotional abhängig von ihrer Peergroup und fühlen sich in einer solchen Situation zugleich immer unwohler in deren Mitte. Im Extremfall wird ein Mädchen, ein Junge gar zum Mobbing-Opfer.
Dieser Zwang zur Konformität birgt eine weitere Gefahr: Da es Jugendlichen wichtig ist, von den Freunden akzeptiert zu werden, sind sie bestrebt, sich der vorherrschenden Kultur ihrer Clique anzupassen – selbst wenn sie dabei Risiken eingehen, sich unvernünftig oder gar rechtswidrig verhalten.
Nur wenige können es sich leisten, diesem Gruppendruck zu widerstehen – etwa erfolgreiche Sportler oder solche Schüler, denen es besonders leichtfällt, auf andere zuzugehen, enge Bande mit vielen Gleichaltrigen zu knüpfen. Für alle anderen ist vor allem eines wichtig: dazuzugehören.
Wie stark sich die Mitglieder einer Peergroup gegenseitig beeinflussen, lässt sich allerdings nicht immer leicht beurteilen. Schließlich finden sich in den Cliquen meist jene zusammen, die einander schon von Beginn an ähnlich sind: Unruhestifter umgeben sich mit anderen ihres Schlages, Lernwillige schließen sich anderen ehrgeizigen Schülern an. Dennoch kommt es durchaus vor, dass sich bestimmte Verhaltensweisen innerhalb der Gruppe übertragen, ein vormals unauffälliger Jugendlicher plötzlich zunehmend negativ in Erscheinung tritt.
Eltern können eine Menge tun
Da ist es kaum verwunderlich, dass wissenschaftliche Studien zeigen: Hat ein Heranwachsender Kontakt zu Cliquen, in denen viel geraucht, getrunken oder gekifft wird, erhöht sich das Risiko, dass er selbst zu Drogen greift. Und begehen einige aus der Gruppe Ladendiebstähle, stacheln sie auf diese Weise auch jene an, die sonst nie auf die Idee gekommen wären, zu stehlen.
Obendrein können sich problematische Verhaltensweisen in Peergroups noch verstärken: Durch den regelmäßigen Kontakt mit Gleichgesinnten bestätigen sich die Heranwachsenden beispielsweise darin, dass Zigarettenrauchen cool ist. Sie durchlaufen auch in dieser Hinsicht gewissermaßen einen Sozialisationsprozess, entwickeln etwa eine entsprechende „Raucher-Identität“.
Wie stark dieser Gruppeneffekt ist, zeigt eine Langzeiterhebung in Berlin: Rauchen etwa viele gute Freundinnen und Freunde von elf- bis 17-jährigen Kindern, so ist das statistische Risiko, dass diese Heranwachsenden auch selbst rauchen, etwa 15-mal höher als bei Kindern ohne rauchende Freunde.
Auch tendieren Teenager eher dazu, sich mit anderen zu prügeln und mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten, wenn sie Kontakt zu gewaltbereiten Freunden haben. Benachteiligte Jugendliche in ärmeren Stadtvierteln tragen dabei ein besonders hohes Risiko.
Sie finden sich zuweilen weniger aus Sympathie zusammen als schlicht aus Mangel an Alternativen. Solche Cliquen sind mehr Schicksalsgemeinschaften als selbst erwählte Kreise, in ihnen verschärfen sich problematische Verhaltensweisen mitunter schnell.

Damit es gar nicht erst so weit kommt, können Eltern eine Menge tun – und zwar bereits lange bevor die Pubertät bei ihren Kindern einsetzt. Denn Entwicklungspsychologen stellen immer wieder fest: Was Väter und Mütter ihren Kindern in jungen Jahren vorleben, prägt deren Verhalten im Jugendalter maßgeblich, etwa den Wert von Bildung und Hilfsbereitschaft. Oder im Gegenteil: risikohaften Alkohol- oder Tabakkonsum.
Indem Mädchen und Jungen ständig ihre Eltern beobachten, entwickeln sie schon im Alter von sechs bis zehn Jahren etwa ein Gespür dafür, welcher Alkoholkonsum alltäglich (und damit scheinbar normal) ist oder welchen Stellenwert Zigaretten für manche Menschen haben.
Daher sind Kinder von Rauchern besonders gefährdet, ebenfalls frühzeitig zu Zigaretten zu greifen, und Kinder von Alkoholikern tragen ein hohes Risiko, selber unverhältnismäßig viel Bier, Schnaps und Wein zu trinken.
Kommen Töchter und Söhne dann in die Pubertät, können Eltern zwar kaum mehr bestimmen, mit wem sich ihre Kinder anfreunden – doch Studien zeigen, dass es durchaus einen Weg gibt, wie Mütter und Väter die jugendliche Widerstandskraft gegenüber negativen Einflüssen stärken können: dann nämlich, wenn sie ehrliches Interesse an den Peer-Kontakten und der Freizeitgestaltung ihrer Kinder zeigen.
Eltern haben Einfluss, welche Peergroup ihre Kinder wählen
Wenn Eltern aufmerksam bleiben, Kontakt halten, nachhaken, auch unbequeme Fragen stellen, signalisieren sie ihrem Kind, dass es von Bedeutung ist, wertgeschätzt und ernst genommen wird. Wissen die Väter und Mütter, wo sich ihr Nachwuchs regelmäßig aufhält und mit wem er sich trifft, sind die Pubertierenden weniger gefährdet, in Kriminalität verwickelt zu werden, Drogen zu konsumieren oder sich sozial zu isolieren, wie Studien zeigen.
Dies ist eine Gratwanderung zwischen Kontrolle und Vertrauen, zwischen Festhalten und Loslassen. Denn natürlich gilt es auch, den Wunsch der Heranwachsenden nach Selbstständigkeit und Autonomie zu respektieren. Eine allzu rigide Kontrolle der jugendlichen Freizeitgestaltung ist oft sogar kontraproduktiv: Hat ein Teenager das Gefühl, in der Familie nicht verstanden zu werden, reagiert er womöglich mit Trotz und schließt sich ganz bewusst problematischen Charakteren an.
Erst wenn die Erwachsenen ganz und gar nicht mehr zu ihrem Kind vorzudringen vermögen, wenn sich Pubertierende gänzlich abschotten oder über Wochen und Monate aggressiv gegenüber anderen Familienmitgliedern verhalten, sollten Mütter und Väter Beratung suchen – möglichst gemeinsam mit dem Kind.
Einem Therapeuten oder Mediator kann es gelingen, dass Eltern und Kinder wieder ins Gespräch kommen und über Probleme reden.
Wenig hilfreich sind dagegen Verbote. Wer einem Jugendlichen untersagt, seine Freunde zu treffen, löst in der Regel Trotzreaktionen aus. Eher sollten Eltern versuchen, Alternativen zu schaffen – etwa indem sie gezielt andere Kontakte anbahnen. Oder Interesse für Freizeitaktivitäten wecken, bei denen der Teenager unter der Aufsicht von Erwachsenen steht und nicht sich selbst überlassen ist, beispielsweise in einem Sportverein.

Untersuchungen zeigen, dass Eltern auf diese Weise durchaus einen Einfluss darauf haben, welche Peergroup ihre Kinder wählen.
Insgesamt wird das Verhältnis zwischen Eltern und Heranwachsenden in der Pubertät zwar weniger vertraut als in der Kindheit. Doch bei vielen wichtigen Entscheidungen setzen die Jugendlichen nach wie vor auf Ratschläge und Unterstützung ihrer Väter und Mütter – etwa wenn es darum geht, einen Auslandsaufenthalt in Erwägung zu ziehen oder wie die Teenager ihr Klassenziel erreichen, welche Ausbildung die geeignetste ist. Kurz: wenn es um ihre Zukunft geht.
Die Bedeutung der Clique schwindet dagegen allmählich, löst sich im Alter von 18 bis 20 Jahren meist auf, sie hat ihren Zweck erfüllt. Oft besteht der Freundeskreis bei jungen Erwachsenen in leicht veränderter Form weiter. Die jungen Männer und Frauen kommen jetzt nicht mehr so häufig als Gruppe zusammen, sondern verabreden sich in lockerer Runde mit mehreren Paaren. Als Jugendliche waren sie fast ein Drittel ihrer Freizeit in Gesellschaft Gleichaltriger unterwegs (bei Erwachsenen gehört den Freunden weniger als zehn Prozent der Zeit).
Derart viele prägende Momente wie mit ihrer Teenager-Clique werden die jungen Menschen nie wieder mit engen Vertrauten erleben.
Nach einer gewissen Zeit der Distanz, während der die Kinder ihren neuen Platz in der Welt gefunden haben, nähern sie sich den Eltern nun meist wieder an.
Eine neue, gleichberechtigtere Form der Beziehung bildet sich heraus.
Die Erwachsenen sind nun keine Erzieher mehr, sondern eher Berater, Vertraute – also Menschen, deren Liebe und Lebenserfahrung zu einem unverzichtbaren Anker für die jungen Erwachsenen werden.
Und so kommt den Vätern und Müttern, nach der turbulenten Phase des Ablösens, im Leben vieler Kinder nun eine neue Sonderrolle zu.