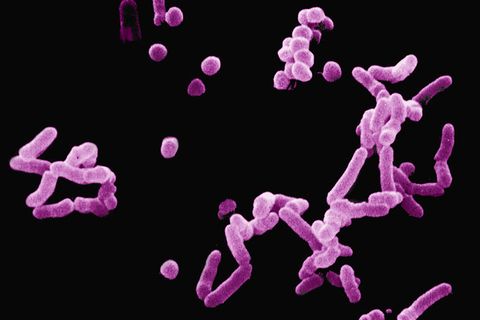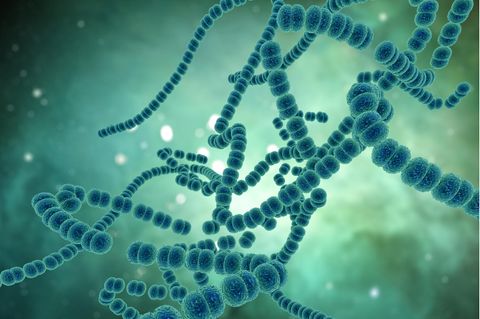Als der Hygieniker George Soper im März 1907 der Erregerquelle, der er über Monate wie ein Detektiv gefolgt war, endlich gegenüberstand, zückte die Quelle eine Tranchiergabel. Mary Mallon war nicht gewillt, dem Fremden Proben ihres Urins, Stuhls und Bluts zu überlassen. Doch als klar war, dass es vermutlich sie, die Köchin, war, die den damals als unheilbar eingestuften Typhus-Erreger an Gäste und Personal weitergegeben hatte, waren ihre Persönlichkeitsrechte nicht mehr viel wert.
Fünf Polizisten und eine Ärztin rückten an, Mallon wurde in ein New Yorker Krankenhaus gebracht. Die Tests waren eindeutig: Die Patientin zeigte zwar keinerlei Symptome der Erkrankung, trug aber Salmonella Typhi, den Typhuserreger, in sich. Sie wurde als Dauerausscheiderin eingestuft. Über verunreinigte Lebensmittel und Wasser wanderten Typhusbakterien aus ihrer Küche in die Straßen von New York und richtet dort Fatales an.
Typhus:
Typhus galt lange als unheilbare Krankheit: Eine schwer verlaufende Infektion endete nicht selten tödlich, im 19. Jahrhundert starb jeder zehnte Infizierte. Die Erkrankung beginnt mit Bauchschmerzen, Übelkeit und Fieber, Komplikationen sind eine Hirnhautentzündung oder Perforation des Darms. Sie kann jedoch auch mild verlaufen und den Infizierten kaum merken lassen, dass er den Erreger in sich trägt. So entstehen stille Träger, „Dauerausscheider“ wie die Köchin Mary Mallon.
Heute gibt es eine Impfung gegen Typhus, Erkrankte werden mit Antibiotika behandelt, auch Dauerausscheider verlieren so ihre Erreger. Gestiegene Hygienestandards und Auflagen für die Lebensmittelbranche sorgten in vielen Regionen der Welt dafür, dass das Typhus abdominalis seine verheerende Wirkung, die es im 19. und 20. Jahrhundert entfaltete, verloren hat. Während in Deutschland 1951 noch 10,6 Personen von 100.000 Einwohnern erkrankten, lag die Zahl 2014 nur noch bei 0,1 Erkrankungen pro 100.000 Einwohnern.
In anderen Regionen der Erde sieht die Situation anders aus. „In Ländern mit unzureichenden hygienischen Bedingungen, zum Beispiel in Afrika, Südamerika und Südostasien, sind besonders hohe Erkrankungszahlen sowie wiederholte Ausbrüche und Epidemien zu verzeichnen“, so das Robert-Koch-Institut. Seit November 2016 verbreiten sich in Pakistan veränderte Paratyphus-Erreger, die gegenüber nahezu allen Antibiotika resistent sind, die zur Behandlung von Typhus abdominalis eingesetzt werden.
Laut WHO erkranken jedes Jahr 11 bis 21 Millionen Menschen an Typhus, Experten gehen von 128.000 bis 161.000 Todesfällen aus. (Stand: September 2018)
Vier Monate lang war Scoper den Spuren Mallons gefolgt, bevor er die damals 37-Jährige fand. Sie sollte sein großer Durchbruch sein: Scoper gilt als der erste Fachmann, der eine Dauerausscheiderin in den USA Identifiziert hatte. Acht Familien hatte er gefunden, bei denen Mallon als Köchin tätig war, in sieben von ihnen grassierte Typhus – mehr als zwanzig Menschen waren erkrankt, ein Kind gestorben.
Als die Tests belegten, was Scoper vermutete, wurde die erste identifizierte Dauerausscheiderin Amerikas in einem kleinen Häuschen des Riverside-Krankenhauses isoliert. Die Situation Anfang des 20. Jahrhundert ist ernst in New York, eine sichere Behandlungsmethode haben die Mediziner zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sie schätzen aber, dass etwa drei Prozent aller Typhus-Erkrankten wie Mallon zu „stillen Trägern“ werden – sie zeigen wenige bis keine Symptome, verbreiten die Erreger jedoch, Dritte infizieren sich und erkranken.

So wurde Mallon zur Sensation, die Presse sprach von „Typhus-Mary“, in einem Brief an ihren Anwalt klagte sie darüber, sie werde als Anschauungsmaterial für Mediziner behandelt. Mit seiner Hilfe ging sie gegen die erzwungenen Quarantänemaßnahmen vor. 1909 verklagte sie die New Yorker Gesundheitsbehörde, ihr Fall landete vor dem Obersten Gerichtshof und löste eine Grundsatzdebatte aus: Wie weit dürfen die staatlichen Autoritäten gehen, um ihre Verantwortung in einer Gesundheitskrise wahrzunehmen? Welches Gut wiegt höher? Das individuelle Recht auf Selbstbestimmung oder das gesundheitliche Wohl der Gesellschaft?
Mallon blieb in Quarantäne. Die Richter wiesen den Vorwurf von Mallons Anwalt zurück, der Staat habe sie ohne Anklage eingesperrt und legitimierten das Handeln der Gesundheitsbehörden – diese hätten in erster Linie die Gesellschaft gegen die Ausbreitung des Typhus zu schützen.
Mallon darf nie wieder als Köchin arbeiten
1910 erlangte Mallon trotzdem ihre Freiheit wieder, der neue Leiter der Gesundheitsbehörde entlässt sie, obwohl verschiedene Behandlungsmethoden keine Wirkung gezeigt hatten und in Mallons Proben weiterhin Typhus-Erreger gefunden wurden. Allerdings galten Auflagen: Nie wieder sollte sie als Köchin arbeiten oder beruflich mit Lebensmitteln zu tun haben.
So wirft der Fall Mallon die zweite Frage auf, die für staatliche Maßnahmen gegen Epidemien bis heute eine enorme Bedeutung hat: Wenn der Staat einschneidende Zwangsmaßnahmen vornimmt - in welchem Umfang muss er dafür sorgen, dass der entstandene, persönliche Schaden ausgeglichen wird?
Als Mallon den Hygieniker Scoper in ihrer Küche mit einem Tranchiermesser drohte, um keine Proben abgeben zu müssen, war sie 37 Jahre alt. Sie hatte keinen Mann, keine Familie, sorgte für sich selbst. Geboren wurde sie in Nordirland, mit 14 wanderte sie aus in die USA, landete später in den Küchen New Yorks und New Jerseys. Bevor sie das erste Mal isoliert wurde, lebte Mallon von der Hand in den Mund, hatte keine feste, eigene Wohnung. Sie sei nachts oft bei einem „unehrenhaften Mann“ untergekommen, ließ Scoper die Öffentlichkeit wissen.
Die Typhus-Erreger waren für Mallon unsichtbar
Heute gehen Wissenschaftler davon aus, dass Mallon sich nie der Tragweite ihrer Infektion bewusst war. Denn sie litt nicht unter den Erregern. Eine Operation, die die Bakterien ausschalten sollte – die Entfernung der Gallenblase –, lehnte sie ab. Die freiheitsraubenden Maßnahmen der Mediziner hatten ihr jegliches Vertrauen genommen. Die Ärzte waren für sie von Heilsbringern zur Bedrohung geworden.
Eine kurze Geschichte der Quarantäne:
Die Kurve abflachen, eine explosionsartige Ausbreitung des Virus vermeiden – das ist zurzeit das Mantra der Virologen, die sich mit dem neuartigen Corona-Virus auseinandersetzen. Die Ausbreitung kann allerdings nur effektiv verlangsamt werden, wenn alle Teile der Gesellschaft ihre sozialen Kontakte einschränken und Infizierte isoliert werden – in Quarantäne.
Die Praxis geht auf alttestamentarische Zeiten zurück: Schon das 3. Buch Mose fordert, dass „Aussätzige“ allein wohnen, ihre Wohnung „außerhalb des Lagers“ liegen solle. Europas erste „Leprosorien“ entstanden 460 n. Chr. in Frankreich – einsam gelegene Hütten für Leprakranke, derer sich fortan die Kirchen annahmen.
Der Begriff „Quarantäne“ für solche Absonderung stammt aus dem Italienischen: Bis zu 40 Tage – quarantina di giorni – wurden Reisende ab 1377 isoliert, bevor sie Handelszentren wie Ragusa (Dubrovnik) oder Venedig betreten durften. Die Städte versuchten, sich so vor dem Pest-Erreger zu schützen. Andersherum demonstrierte es 1665 das englische Dorf Eyam: Als dort die Pest ausbrach, verließen sämtliche Einwohner ihren Ort monatelang freiwillig nicht, um das Vordringen der Seuche zu stoppen. Nur ein Viertel der Bewohner überlebte.
1851 richtete Frankreich die erste Internationale Gesundheitskonferenz aus, um länderübergreifende Quarantäne-Regeln im Kampf gegen Gelbfieber, Pest und Cholera zu entwerfen. Machthaber nutzten das Instrument derweil auch zur Schikane: In den USA wurden 1917 bis zu 30.000 Prostituierte unter dem Vorwand eingesperrt, man wolle Soldaten vor Geschlechtskrankheiten schützen.
Zwischen 1918 und 1920 raffte die Spanische Grippe weltweit geschätzt 50 Millionen Menschen dahin. Nur Australien gelang es dank strenger Quarantäne-Maßnahmen, weitgehend unbehelligt davonzukommen. Deutschland erlebte eine der letzten dramatischen Quarantäne-Aktionen 1970: In Meschede brachen die Pocken aus, 260 Menschen wurden isoliert, 21 erkrankten, vier starben.
So waren es wohl die eigene Not, gepaart mit Unwissenheit und mangelndem Vertrauen, die Mallon zu ihren nächsten Schritten trieben: Kaum war sie auf freiem Fuß, heuerte sie als Köchin an. Sie arbeitete in Hotels, Restaurants, einer Pension.
Als 1915 ein Ausbruch 25 Menschen erkranken ließ, war das New Yorker Gesundheitsamt ihr erneut auf den Fersen. Dass sie jetzt als Mrs. Brown kochte, halft Mallon nicht: Sie wurde zurückgeschickt auf North Brother Island, in die Baracke des Riverside-Krankenhauses – in dauerhafte Isolation.
Kontakt hatte sie nur zu anderen Erkrankten und dem Pflegepersonal. 1938 starb Mary Mallon in den Pflegeräumen auf der Northern Island - nahe der Bronx, weit weg von ihrem Zuhause Nordirland, wo 69 Jahre zuvor ihr Leben begonnen hatte. 26 Jahre dieses Lebens verbrachte Mary Mallon in Isolation – um zu verhindern, dass sich eine Krankheit ausbreitet, unter der sie nie selbst gelitten hatte.