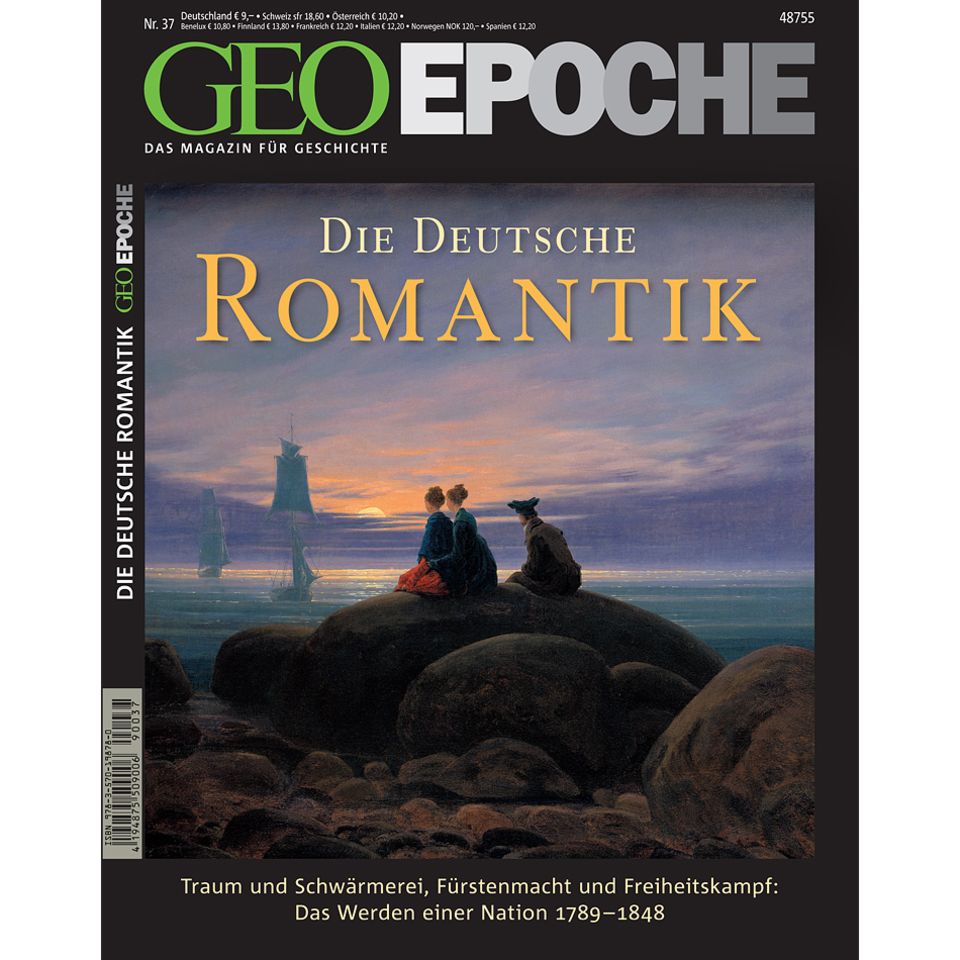Eigentlich hatte Carl Ludwig Sand vor, den Mord schon am Vormittag zu begehen. Doch der Mann, den er töten wollte, war nicht daheim. Und so sitzt er an diesem 23. März 1819, einem Frühlingstag, um die Mittagszeit in einem Mannheimer Gasthaus und isst mit gutem Appetit. Eine Zeitlang plaudert er mit zwei Geistlichen, die sich später vor allem an eines erinnern: seine große innere Ruhe.
Sand, ein 23-jähriger Student, hat sich seit Monaten auf diesen Tag vorbereitet.
Hat eine Anatomievorlesung besucht und sich über die Lage des Herzens informiert. Hat immer wieder das Bekennerschreiben überarbeitet, das er nach der Tat mit der Mordwaffe an eine Tür heften will. Und sich das schulterlange Haar kürzen lassen, das verraten könnte, dass er ein Burschenschafter ist, ein national gesinnter Student.
Am späten Nachmittag steht er wieder vor dem Haus, an dem er schon am Morgen geklingelt hat. Der Diener, der ihm öffnet, erinnert sich sofort - Sand hatte ihm erklärt, er müsse dem Hausherrn einen wichtigen Brief übergeben - und führt ihn ins Wohnzimmer.
Einen Moment später tritt August von Kotzebue durch eine andere Tür in den Raum, der berühmte Schriftsteller, Verfasser von mehr als 200 Theaterstücken, erfolgreicher als Goethe und Schiller. Und in den Augen national gesinnter Männer ein Verräter: Kotzebue schreibt als literarisch- wissenschaftlicher Korrespondent für den Zaren Berichte über die Lage in Deutschland.
Die Klinge zerfetzt August von Kotzebues Lungenarterien
Die beiden Männer wechseln ein paar Worte, dann zieht Sand einen Dolch aus dem Rockärmel und sticht auf den Dichter ein. Die Klinge durchtrennt eine Rippe, zerfetzt die Lungenarterien, schneidet in den Herzbeutel.
Kotzebue fällt zu Boden und stirbt wenige Minuten später.
Es ist das spektakulärste Attentat in der deutschen Geschichte seit der Ermordung des Feldherrn Albrecht von Wallenstein 185 Jahre zuvor. Das Attentat eines Mannes jedoch, der nicht aus Machtgier tötet, sondern für eine politische Idee.
Carl Ludwig Sand, Theologe und frommer Protestant, wird zum Mörder für eine Sache, die ihm so heilig ist wie der dreifaltige Gott. Er tötet für das Vaterland; für eine deutsche Nation, die bislang nur in Träumen existiert.
Für eine Idee, die geboren wurde in den Köpfen von Dichtern, Philosophen, Studenten, Professoren und Lehrern.
Deutschland, in den Jahren nach 1806: Napoleon hält weite Teile des Landes besetzt, das Heilige Römische Reich deutscher Nation existiert nicht mehr. Immer mehr patriotische Intellektuelle sehen den Grund dafür in der seit Jahrhunderten andauernden Zersplitterung Deutschlands in wenige Groß- und Mittelstaaten und mehrere Dutzend winziger Herrschaften.
Es gibt keine deutsche Nation, sondern Preußen und Bayern, Untertanen des sächsischen Königs und des Fürsten von Hessen-Darmstadt, der Herrscher von Salm-Salm und Isenburg-Birstein und der vielen weiteren Kleinstaaten.
Nun aber beschwören Professoren und Dichter, die sich für die Ideen der Französischen Revolution begeistern, in Vorlesungssälen und literarischen Salons die deutsche Vergangenheit, schwärmen für vermeintliche Freiheitskämpfer wie den Reformator Martin Luther, der den Kampf gegen das römische Papsttum wagte und den sie als deutschen Helden verehren.
Johann Gottlieb Fichte, Professor für Philosophie an der Universität Berlin, erklärt die Deutschen in seinen Vorlesungen zum "Urvolk" Europas. Und der Greifswalder Schriftsteller Ernst Moritz Arndt dichtet:
"Was ist des Deutschen Vaterland?
Ist's Preußenland? Ist's Schwabenland?
Ist's, wo am Rhein die Rebe glüht? Ist's, wo am Belt die Möwe zieht?
O nein, nein, nein! Sein Vaterland muss größer sein!" Männer wie Fichte und Arndt fordern neben der Einheit auch Freiheit. Das neue Deutschland soll ein Verfassungsstaat werden, eine konstitutionelle Monarchie, in der das Volk über Parlamente mitregiert. Freiheit und Einheit gehören in dieser Zeit zusammen: Wer ein Patriot ist, will auch einen Verfassungsstaat - und umgekehrt.
Doch was nützen feurige Worte gegen einen waffenstarrenden Gegner? 1811 eröffnet der preußische Gymnasiallehrer Friedrich Ludwig Jahn in Berlin eine Turngesellschaft: Durch Sport will er die Jugend für einen Krieg gegen Napoleon stählen und ihr vaterländisches Gemeinschaftsgefühl stärken.
Vor allem Gymnasiasten und Studenten treffen sich hier zum Fechten, Armbrustschießen und zu nächtlichen Märschen. Rasch breitet sich die Bewegung aus: 1818 üben in 150 Städten bereits mehr als 12 000 Turner.
Jahn plant, auch an den Universitäten patriotische Gruppen zu gründen.
Bislang herrschen dort die Landsmannschaften - Vereinigungen, in denen sich die Studenten nach Heimatländern getrennt treffen: An der Universität von Jena etwa sammeln sich Franken in der Landsmannschaft "Franconia", die Sachsen in der "Saxonia".
Jahn und einige seiner Mitstreiter wollen nun Studenten (auch "Burschen" genannt) aus allen deutschen Ländern zusammenbringen. National eingestellte Professoren und Turner verbreiten die Idee. Noch steht dabei der Kampf gegen die Besatzer im Vordergrund.
Es dauert, bis sich Jahns Idee durchsetzt. Erst die 1813 beginnenden Befreiungskriege bringen den Durchbruch: Rund 2500 Studenten, fast die Hälfte aller deutschen Hochschüler, melden sich als Freiwillige für den Kampf gegen Napoleons Truppen. Nach ihrer Rückkehr an die Universitäten gründen sie die ersten patriotischen Gruppen.
Am 12. Juni 1815 versammeln sich in Jena, das zum Territorium des liberalen Weimarer Großherzogs gehört, mehr als 140 Studenten auf dem Marktplatz. In langen Reihen ziehen sie aus der Stadt hinaus zu einem Gasthaus, wo sie die Fahnen der alten Landsmannschaften niederlegen und die erste "deutsche" Burschenschaft gründen; die Epoche der universitären Kleinstaaterei ist in Jena damit vorüber.
Burschenschafter tragen eine "altdeutsche Tracht"
Die Mitglieder der neuen Vereinigung treffen sich in Privatquartieren, in Kneipen, zu Ausflügen und Turnübungen. In ihren Versammlungen debattieren sie über patriotische Artikel, preisen in Liedern "deutsche Treue" und "Deutschlands Rittertum". Und hoffen, dass die Fürsten in ihren Ländern bald Verfassungen einführen - so wie sie es gerade auf dem Wiener Kongress angekündigt haben.
Schon durch ihre Kleidung grenzen sie sich von den Landsmannschaften ab. Statt prächtigen Uniformen mit goldenen Stickereien und Epauletten tragen Burschenschafter eine "altdeutsche Tracht", die an die Mode des 16. Jahrhunderts erinnern soll: ein weißes Hemd mit breitem Kragen, darüber einen schwarzen Rock, außerdem ein Barett über dem lang herabwallenden Haar.
Auch in anderen deutschen Städten schließen sich Studenten zu Burschenschaften zusammen: in Berlin, Breslau, Göttingen - und in Erlangen, wo seit Beginn des Jahres 1816 der Theologiestudent Carl Ludwig Sand patriotisches Gedankengut verbreitet.
Sand ist ein verschlossener und schwermütiger Mann; schwärmerisch und gefühlvoll nur dann, wenn es ums Vaterland geht.
Als Elfjähriger erlebt er 1806, wie die Franzosen in seiner Heimatstadt Wunsiedel die Macht übernehmen und seinem Vater, einem früheren Justizrat, die Pension streichen. Vier Jahre später wechselt er auf das Gymnasium in Hof - und erlebt Napoleon bei einer Truppeninspektion.
Aus Protest verlässt er die besetzte Stadt.
Der Schüler liest die Schriften Jahns, begeistert sich für "Wilhelm Tell", Schillers Drama um den Schweizer Freiheitshelden, der gegen fremde Unterdrücker kämpft. 1815, gegen Ende der Befreiungskriege, zieht er selbst in den Kampf, kommt aber nicht mehr an die Front. Er bedauert für den Rest seines Lebens, nie einen Franzosen getötet zu haben.
Die Universität Erlangen, an der Sand nach Kriegsende Theologie studiert, ist noch immer eine Bastion der alten Landsmannschaften. Sand, der die Burschenschaftsidee zuvor in Tübingen kennengelernt hat, versucht dies zu ändern.
In einer Sommernacht des Jahres 1816 lädt er eine Reihe von Freunden auf einen Berg nahe der Stadt, um dort die Erlanger Burschenschaft zu gründen.
Nur etwas mehr als zehn kommen, einige kehren noch auf dem Weg wieder um: aus Angst davor, bei den Landsmannschaften "in Verruf" zu geraten und damit an allen deutschen Universitäten als "ehrlose Burschen" zu gelten.
Bei Mondschein legen die Männer einen Schwur ab, Sand hält eine kraftvolle Rede, schließlich endet die Gründungsfeier in einem Trinkgelage.
Sand arbeitet mit einigen Mitstreitern eine mehr als 400 Paragrafen lange Verfassung aus. Die neue Vereinigung soll ein Vorbild für einen künftigen deutschen Nationalstaat sein und ist wie die Urburschenschaft in Jena demokratisch aufgebaut. Letzte Entscheidungen trifft bei schwerwiegenden Differenzen eine Versammlung aller Mitglieder.
Die Organisation steht allen deutschen Studenten offen, mit Ausnahme der Juden, für Sand die "Feinde aller Volkstümlichkeit".
Doch nicht einmal 40 Studenten treten der Burschenschaft bei. Sand und seine Freunde gelten als Sonderlinge - schon wegen ihrer altdeutschen Kleidung.
Als Sands engster Freund beim Baden ertrinkt, verhöhnt ein Student einer Landsmannschaft den Toten: "Einer von diesen Hunden weniger".
Die Burschenschafter kündigen daraufhin an, bewaffnet zur Beerdigung zu kommen - um weitere Beleidigungen sofort zu rächen. Der Leichenzug muss von der Polizei gesichert werden.
Deprimiert und enttäuscht zieht Sand im Herbst 1817 nach Jena, ins Zentrum der Burschenschaftsbewegung.
Dort bereiten seine Gesinnungsgenossen gerade ein großes Fest vor: Sie haben Studenten auf die Wartburg bei Eisenach eingeladen, um den Jahrestag des Sieges über die Franzosen zu feiern und an den 300. Jahrestag der Reformation zu erinnern.
Die Idee einer deutschen Nation hält Kotzebue für Spinnerei
Etwa 500 Studenten versammeln sich am 18. Oktober auf dem Eisenacher Marktplatz. Bei Glockengeläut ziehen sie zur Wartburg hinauf. Carl Ludwig Sand schreitet direkt hinter der Fahne der Jenaer Urburschenschaft - eine Ehre, die er sich mit seiner mühsamen Arbeit in Erlangen verdient hat.
Prächtig glänzt das seidene Banner in der Herbstsonne; die rot-schwarz-roten Streifen, der Saum aus goldenen Fransen und der goldene Eichenzweig, der schräg auf die Fahne gestickt ist.
Jeder im Zug kennt diese Farben: Es sind die gleichen wie auf den Uniformen des berühmten "Lützowschen Freikorps" (siehe Seite 62), in dem während der Befreiungskriege viele Studenten mitgekämpft haben.
Die Burschenschafter haben eine enttäuschende Zeit hinter sich. Die nationale Aufbruchstimmung ist mit dem Sieg über Napoleon in Vergessenheit geraten, der 1815 auf dem Wiener Kongress geschaffene "Deutsche Bund" nicht mehr als ein lockerer Zusammenschluss von Einzelstaaten und Freien Reichsstädten.
Und mit Ausnahme des Weimarer Großherzogs und der Regenten einiger Kleinstaaten hat kein Fürst die bei der Gründung des Deutschen Bundes versprochene Verfassung eingeführt.
Davon spricht, im Festsaal der Burg, der Hauptredner des Tages, ein Jenaer Theologiestudent: "Das deutsche Volk hatte schöne Hoffnungen gefasst, sie sind alle vereitelt. Alles ist anders gekommen, als wir erwartet haben." Dann fordert er die Anwesenden auf, wie "eine eherne Mauer" zusammenzustehen "gegen jegliche äußere und innere Feinde".
Am Abend verbrennen die Studenten auf einem nahe gelegenen Berg symbolisch eine Reihe von "Schandschriften des Vaterlandes", etwa den Code Napoleon, das Gesetzbuch aus der Zeit der verhassten Franzosenherrschaft, sowie die Schrift "Germanomanie", in der der jüdische Schriftsteller Saul Ascher die Nationalbewegung scharf angreift.
Einer der Studenten hält eine Buchattrappe aus Altpapier hoch, ein anderer nennt den Titel, ein dritter wirft den Papierpacken in die Flammen. Auf diese Weise brandmarken sie rund 30 Werke.
Darunter ist auch die "Geschichte des Deutschen Reiches" des Dichters August von Kotzebue: In dem Buch verteidigt Kotzebue, der als Beamter am Zarenhof Karriere gemacht und für seine Verdienste einen Adelstitel erhalten hat, die absolute Monarchie als beste Staatsform.
Die Idee einer deutschen Nation hält er für Spinnerei.
Sand kannte Kotzebue bis dahin nur als Lustspieldichter. Am Feuer nimmt er ihn erstmals als Feind der vaterländischen Sache wahr. Tatsächlich greift Kotzebue in den nächsten Monaten die Burschenschaften in Zeitungsartikeln öffentlich an, verspottet die nationale Bewegung als "Turn- und Studenten- Unwesen".
Die Empörung der Burschenschafter nimmt noch zu, als bekannt wird, dass Kotzebue auch nach seiner Rückkehr aus Russland für den Zaren arbeitet: Monatlich liefert er dem russischen Herrscher gegen Honorar Einschätzungen der deutschen Politik.
Eines dieser geheimen Schreiben wird ihm Ende 1817 von einem Unbekannten gestohlen und kurz darauf in der patriotischen Zeitschrift "Volksfreund" publiziert: ein sehr scharfer, abschätziger Bericht über die ebenfalls vaterländische Zeitschrift "Nemesis".

Kotzebue strengt mehrere Prozesse gegen die Veröffentlichung an, doch das steigert die Aufmerksamkeit nur noch.
Patriotischen Deutschen gilt er fortan nicht nur als Feind der Demokratie, sondern als verachtenswerter Spion.
Im Mai 1818 notiert Carl Ludwig Sand in seinem Tagebuch: "Wenn ich so sinne, so denke ich oft, es sollte doch einer mutig über sich nehmen, dem Kotzebue das Schwert ins Gekröse zu stoßen." Er schließt sich den "Unbedingten" an, einer kleinen, extremen Gruppe innerhalb der Jenaer Burschenschaft.
Gründer dieses Kreises ist Karl Follen, ein Privatdozent für Jura.
Follen denkt radikaler als viele andere: Er fordert den gewalttätigen Umsturz und eine deutsche Republik.
"Nieder mit Thronen, Kronen, Drohnen und Baronen! Sturm!", schreibt er in einer Flugschrift und ruft in einer anderen dazu auf, die Fürsten zu töten: "Freiheitsmesser gezückt! Hurra, den Dolch in die Kehle gedrückt!" Sein Kalkül: Wenn ein paar junge Patrioten eine solche Tat begehen, wenn sie es wagen, sich gegen die Mächtigen zu erheben, muss dies im Volk eine Revolution anstoßen. Moralische Skrupel hat Follen nicht. Man müsse Attentate "einfach zu den Mitteln zählen, durch welche, wenn andere Mittel fehlen, die Volksfreiheit zu erringen ist".
Sand ist fasziniert, denn Follen fasst das in Worte, was er schon lange fühlt.
Der Theologiestudent beschließt, August von Kotzebue zu ermorden - obwohl Follen nie davon gesprochen hat, auch Fürstengünstlinge zu töten.
Es ist allein Sands Entscheidung, und er erzählt niemandem davon. Zur Vorbereitung seiner Tat reist er nach Berlin und lernt bei Jahns Turnern den Umgang mit dem Dolch.
In Jena überfällt er zur Probe mit einem Holzstück in der Hand einen Kommilitonen und stellt fest: Wenn er mit der linken Faust einen Schlag ins Gesicht antäuscht, reißt der andere instinktiv die Arme hoch - und die Brust ist ungeschützt.
Genauso will er es machen. Anfang März 1819 erklärt er Freunden, er müsse in dringenden Familienangelegenheiten verreisen. Dann bricht er in Richtung Mannheim auf, um - wie es in seinem Bekennerschreiben heißt - "einen Brand zu schleudern in die jetzige Schlaffheit".
Eines jedoch hat er nicht bedacht: Seine eigene Tat wird ihn derart erschrecken, dass er selbst nicht weiterleben mag.
Nachdem Sand den Dichter niedergestochen hat, steht plötzlich Kotzebues vierjähriger Sohn in der Tür.
Offenbar von Schuldgefühlen gepackt, drückt Sand dem Diener sein Bekennerschreiben in die Hand und stürzt aus dem Haus. Auf der Straße kniet er nieder und ruft: "Gott, ich danke Dir für diesen Sieg." Dann stößt er sich einen zweiten Dolch in die Brust.
Menschen laufen zusammen, ein Schustergeselle zieht Sand die Waffe aus der Brust, eine Hebamme reißt seine Weste auf und wäscht die Wunde mit Essig.
Auf einer Trage wird er ins Hospital gebracht. Ärzte operieren ihn, doch die Wunde schließt sich nicht mehr - für den Rest seines Lebens kann Carl Ludwig Sand das Bett kaum noch verlassen.
Die Zeitungen berichten wochenlang. Überall reden die Menschen über Sands Tat. Auch wenn selbst viele Burschenschafter Mord als Mittel der Politik ablehnen, so bewundert man ihn doch: für den Mut und die Entschlossenheit - und für seine edlen Ziele. Sand, der Kämpfer fürs Vaterland, wird zum Volkshelden.
Carl Ludwig Sand bereut nichts
Vor dem Hospital in Mannheim versammeln sich Menschen, klatschen Beifall und lassen ihn hochleben. Als man ihn nach der Operation ins Gefängnis bringt, schicken ihm die Bürger beinahe täglich Blumen oder Obst.
Einige Monate später beginnt der Prozess. Sand rechnet mit den Herrschern ab: "Ihr Fürsten solltet allezeit die Meister und Ersten im Volke sein, und Ihr habt Euch meist überall als die Schlechtesten benommen. Jammer und Not im Lande rühren Euch nicht." Das Urteil fällt aus, wie von Sand erwartet: Tod durch Enthaupten. Als ihm Justizbeamte die Nachricht bringen, der Großherzog von Baden habe das Urteil bestätigt, erklärt Sand, er sterbe gern, wenn es keine Möglichkeit gebe, für seine Idee vom Vaterland zu leben.
Am 20. Mai 1820, gegen fünf Uhr früh, sitzt er in einer Kutsche und fährt durch Mannheim, bewacht von mehreren Wärtern. Mehr als 2500 Soldaten sichern die Hinrichtung. Einige Studenten winken mit ihren Mützen, rufen: "Lebe wohl, lieber Sand." Nach kurzer Fahrt erreicht der Wagen den Richtplatz, wo ein Eichensarg bereitsteht. Wärter tragen den Verurteilten auf das Schafott.
Der bereut nichts. "Ich sterbe in der Gnade meines Gottes", sagt er, als er an den Richtstuhl gebunden wird. Dann bittet er noch, man möge ihm die Augenbinde etwas höher setzen. Der Scharfrichter greift das Schwert mit beiden Händen, holt aus und trennt mit zwei Schlägen den Kopf vom Rumpf.
Da ist längst klar, dass Sands Tat vergebens war. Zwar versucht ein patriotischer Apothekergeselle kurz nach der Ermordung Kotzebues, den nassauischen Regierungspräsidenten zu töten, doch die ersehnte Volkserhebung bleibt aus. Im Gegenteil: Die Fürsten nehmen Sands Tat zum Anlass, die liberalnationale Opposition zu zerschlagen.
Bereits wenige Monate nach dem Attentat werden Burschenschafter und führende Patrioten wie Friedrich Ludwig Jahn verhaftet. Im August 1819 entwerfen Minister der deutschen Staaten im böhmischen Kurort Karlsbad eine Reihe antiliberaler Gesetze, die der Bundestag in Frankfurt per Eilverfahren verabschiedet. Rechtzeitig vor der einsetzenden Verhaftungswelle kann Karl Follen 1820 ins Ausland fliehen.
Fortan sind die Burschenschaften verboten, die Turnplätze geschlossen, und an den Universitäten werden verdächtige Studenten und Hochschullehrer beschattet. Zudem verfolgt eine Kommission zur Untersuchung "revolutionärer Umtriebe und demagogischer Verbindungen" die Patrioten.
National gesinnte Professoren müssen mit ihrer Entlassung rechnen - und wer einmal entlassen ist, wird meist in keinem anderen deutschen Staat wieder eingestellt.
Studenten, die sich trotz des Verbots in patriotischen Vereinigungen treffen, sind auf Lebenszeit vom Staatsdienst ausgeschlossen. Und niemand darf mehr aufrührerische Gedanken äußern: Zeitschriften und Bücher mit weniger als 320 Seiten müssen einem Zensor vorgelegt werden - politisch verdächtige Schriften sind eher schmal.
Zwar setzen nicht alle Regierungen des Deutschen Bundes die "Karlsbader Beschlüsse" so streng um wie Preußen und Österreich - in Jena und an einigen anderen Universitäten treffen sich die Burschenschafter heimlich weiter.
Doch der nationale Aufbruch ist gescheitert. Und es wird mehr als ein Jahrzehnt dauern, ehe es Menschen wieder wagen, offen ein anderes Deutschland zu fordern.
Die Erinnerung an Sand aber hält die Ziele der Nationalbewegung wach. Patrioten legen am Ort seiner Hinrichtung Blumen nieder, dichten Lieder über den Attentäter und verehren Holzspäne, die sie aus dem Schafott herausgebrochen haben, wie Reliquien.
Der Scharfrichter, der sein Amt nach der Hinrichtung erschüttert aufgegeben hat, baut aus den Resten des Blutgerüsts eine Hütte in den Weinbergen bei Heidelberg. Dort versammeln sich noch viele Jahre lang Burschenschafter zu heimlichen Treffen - und zum Gedenken an ihren ersten Märtyrer.