GEO.de: Herr Fothergill, welche Rolle spielen Sie im Kampf gegen den Klimawandel? Wie wichtig ist es, die verbleibende Schönheit unseres Planeten zu zeigen?
Alastair Fothergill: Einfach ausgedrückt: Warum sollten die Menschen sich um etwas scheren, dass sie nicht kennen? Für Planet Erde haben wir erstmals Schneeleoparden in der Wildnis gefilmt und kurz darauf startete der WWF eine Kampagne, um den Schutz der Tiere zu finanzieren. In einer immer stärker urbanisierten Gesellschaft sind diese Filme oft der einzige Zugang zur Natur. Auf der anderen Seite fragen sich die Leute: Wie können wir den Planeten noch retten? Und eines ist glasklar: Unser größter Verbündeter zur Lösung dieser drängenden Probleme, die wir selbst geschaffen haben, ist die Biodiversität.
Die Vielfalt der Natur also. Warum gerade die?
Weil sie den effizientesten Weg liefert, Kohlenstoff in Ozeanen und Wäldern zu binden. Es ist bewiesen, dass der Indische Regenwald mit all seinen Tigern dafür zwei Mal so effektiv ist wie eine simple Plantage. Wenn wir noch irgendeine Chance haben, die Situation auf unserem Planeten wieder zu kippen, geht das nur, wenn wir ihn wieder verwildern.

Alastair Fothergill - der mit der Kamera die Wildnis erklärt
Noch während der Brite Zoologie in Durham studierte, drehte er seinen ersten Film On the Okavango in Botswana - bis heute einer seiner Lieblingsplätze in der Natur, vor allem wegen des für diesen Teil Afrikas ungewöhlich klaren Wassers. Auf das Debüt folgten zahlreiche Filme und Serien – eine Erfolgsgeschichte. Fothergill arbeitete für das Natural History Team der BBC, produzierte Meilensteine wie Unser blauer Planet, Deep Blue oder Planet Erde.
Die Netflix-Serie Unser Planet wurde im April 2019 veröffentlicht. Fothergill und Keith Scholey leiteten die Aufnahmen, im Oritinalton kommt die Stimme aus dem Off von der heute 93-jährigen Sprecherlegende David Attenborough. In acht Teilen streift sie durch die verschiedensten Lebenswelten, die der Klimawandel in Gefahr bringt - die Reise führt von der Arktis durch die Ozeane bis in vertrockneten Wüsten und verschlungene Wälder.
Fothergill und Scholey haben diese Reise auch analog in einem 300 Seiten starken Bildband veröffentlicht. Wie die Website zur Serie soll er interessierten Zuschauern einen noch tieferen Einblick in die Ursachen der Gefahren liefern, denen Wildtiere auf der ganzen Welt heute ausgesetzt sind.
Wie soll das konkret funktionieren?
Meereswissenschaftler haben folgende Prognose erarbeitet: Wären nur 30 Prozent der Meere geschützte Gebiete, würden sie in ihr Gleichgewicht zurückfinden. Und das ist nur ein Beispiel. Ich glaube, es ist wichtig, auch solche positiven Botschaften zu vermitteln. Wenn du ihnen keine Lösungen lieferst, stecken die Leute den Kopf in den Sand und sagen: Na ja, wenn der Planet so beschädigt ist, kann ich ja nichts machen – außer seine letzten Schönheiten zu genießen.

Aber ändert sich nicht genau das im Moment? Jeden Freitag demonstrieren tausende Schüler gegen klimaschädliche Politik, bereits jetzt ist diese Generation dafür bekannt, klügere, punktuellere Lösungen für klimarelevante Probleme zu finden.
Das stimmt absolut und ist wunderbar – und zugleich sehr verständlich. Erst heute habe ich mich mit David Attenborough darüber unterhalten, der ist 93 und sorgt sich schrecklich um den Klimawandel. Aber er wird nicht Davids Problem sein, sondern das meiner Kinder. Als ich vor knapp 30 Jahren in der Branche anfing, war dieses Problembewusstsein nicht vorhanden. Ich habe mich einmal selbst gefragt: Wann hast du denn wirklich vom Konzept der Erderwärmung gehört? Das war Ende der neunziger Jahre. Erst in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren hat sich die Krise herauskristallisiert. Dass dieser Gedanke von jungen Menschen angeführt wird, ist richtig so. In diesem Sinne muss die Krise auch als Chance verstanden werden. Die erneuerbaren Energien sind die Industrie, die im Moment in den USA am meisten Arbeitsplätze schafft. Wir müssen mit einer positiven Einstellung an die Sache rangehen. Ich setze große Hoffnungen in die junge Generation, sie ist sehr reflektiert, was das angeht.

Für die extremen Nahaufnahmen von Tiefseefischen oder Ameisenkolonien ist modernste Technik ebenso unentbehrlich wie für Szenen von Geparden, die Antilopen jagen. Abgesehen von den thematischen Verschiebungen: Haben technische Innovationen das Filmemachen in der Natur in 30 Jahren von Grund auf verändert oder ist es immer noch das selbe Prinzip – nur mit anderen Geräten?
Es gibt verschiedene Arten von Naturfilmern. Manche stellen die Technik sehr in den Vordergrund, in ihren Filmen erklären sie ihr Equipment. Ich persönlich will, dass die Kamera niemals zwischen den Zuschauern und dem Wildtier steht. Zur Wahrheit gehört aber auch: Willst du Menschen zum Beispiel Pflanzen näherbringen, musst du sie im Zeitraffer filmen – nur wenn du siehst wie Pflanzen wachsen, kannst du ihr Naturell verstehen. Viele Tiere kann man nicht ohne beeindruckende Makroaufnahmen in Szene setzen. Da gibt es jedes Jahr neue technische Durchbrüche, die es uns ermöglichen, die Natur ganz anders zu zeigen.
Welche denn konkret?
Die größte Veränderung war die rasante Steigerung der technischen Qualität der Fotografie. Ich meine, ich habe mit 16-mm-Filmen angefangen, für Planet Erde nutzten wir High Definition. Jetzt sind wir bei einer Auflösung von 4K. Die Schärfe hat sich mit den Jahren vervielfacht. Der wirkliche Durchbruch aber war HDR, High Dynamic Range. Das bedeutet eine wahnsinnig hohe Pixelzahl, also eine gute Auflösung. Dynamic Range beschreibt das mögliche Farbspektrum innerhalb jedes einzelnen Pixels. Das alles klingt nach langweiligem Technikkram, ich weiß. Aber es bedeutet, dass wir Bilder produzieren können, die viel reicher an unterschiedlichen Farben sind.
Und das ist wichtiger als neue Perspektiven durch Drohnen?
Nein, auch die sind elementar. Zum Beispiel unser Cineflex, ein riesiges System, das eine Linse mit langer Brennweite stabilisiert. Ist es an einen Helikopter montiert, so können wir wahnsinnig hoch fliegen und Tiere filmen, ohne sie zu stören: Wir folgen Wölfen, die Bisons jagen - das wäre von Land aus unmöglich, denn wir würden sie sofort verlieren.
Und wie verfolgen Sie Tiere auf Augenhöhe?
Für Unser Planet haben wir Cineflex auf alle möglichen Fahrzeuge geschraubt, auf Schneemobile zum Beispiel. Es ist unglaublich schwierig, einen Eisbären mit einem festen Stativ zu filmen. Die Inuit nennen die Tiere Wanderer, sie sind immer in Bewegung. Mit der langen Linse auf dem Schneemobil können wir ihnen folgen. Die Kamera ist weit weg, aber auf Augenhöhe mit dem Eisbären, der Zuschauer nimmt seine Perspektive ein. Ich liebe diese Sequenzen, weil sie die Seele der Tiere einfangen. So haben wir auch jagende Geparden gefilmt. Der Zuschauer bewegt sich in den Fußstapfen der Raubkatzen. Die meisten haben keine Ahnung von der Technik, die dahintersteckt – aber durch sie können sie besser verstehen, was die Wildtiere wirklich tun.

Für Unser Planet haben Sie und ihre Teams in den vergangenen Jahren in über fünfzig Ländern gedreht. Im April ist die Serie auf Netflix erschienen – welche Momente der Arbeit sind haften geblieben?
Das sind natürlich die Sequenzen, die man selbst gedreht hat. Zum Beispiel, als ich Zeit mit den Eisbären im arktischen Svalbard verbringen durfte. Dort verändert sich das Eis dramatisch schnell - und man registriert diese sehr mächtige Veränderung. Für die Serie wollten wir in die Tiefe der Probleme gehen, mit der unsere Natur kämpft. Wir wollten sie nicht in den letzten fünf Minuten abhandeln, es sollte das Narrativ aller Episoden sein. Außerdem wollten wir mehr sagen als nur: Der Planet ist in Gefahr. Wir haben versucht, für jeden Lebensraum, den wir beleuchten, zu erklären, warum er in Gefahr ist. Deshalb haben auch die unfassbar schnell schmelzenden Gletscher in Grönland die Zuschauer am meisten bewegt, glaube ich.
Warum gerade die?
Das Klima wandelt sich – offensichtlich – seit Jahrzehnten. Aber an diesen Gletschern in Grönland kannst du dem Klima dabei zusehen, sie schmelzen schneller als alle anderen auf der Welt. Oder nehmen Sie die Szene mit den Walrössern in Russland. Wir zeigen, wie sich hunderte Tiere an Stränden sammeln, wegen fehlender Eisfläche klettern sie immer weiter die Klippen hoch und stürzen dort in den Tod – eine sehr wichtige Szene für uns. Wir wollten nicht pure Zerstörung filmen, sondern den Wandel aus der Perspektive der Tiere wahrnehmen.

Den Titel haben Sie sicher nicht zufällig gewählt: Warum Unser Planet und nicht Der Planet?
Das ist richtig, den haben wir sehr bewusst gewählt, weil das Wort Unser zwei Dinge impliziert: Eigentum und Verantwortlichkeit. Und ausdrückt: Es ist unser Planet und wir haben nur einen - also müssen wir für ihn sorgen.
Allerdings kommen in Ihren Filmen keine Aktivisten, keine Wissenschaftler, keine Politiker zu Wort. Ist es überhaupt möglich, über den Klimawandel zu berichten, ohne den Menschen darin vorkommen zu lassen?
Klar, die Frage ist, ob man so die Wildnis nicht durch eine rosarote Brille zeigt. Eine sehr gute Frage, weshalb wir das Projekt auch mit einer Homepage begleiten. Dort finden Sie viele Menschen, die die Geschichte aus ihrer Perspektive erzählen, endlose Fakten und mehr. Aber es gibt auch die andere Seite: Für die Dschungel-Episode von Unser Planet haben wir eine Orang-Utan-Mutter gefilmt, die ihrem Baby das Leben zeigt. Orang-Utans haben nach Menschen die längste Mutter-Kind-Bindung, zirka acht Jahre. Was mit dem Regenwald in Borneo passiert, erzählen wir am Schicksal der beiden.

Stehen solche Narrative bereits vor so einem Dreh fest oder gehen Sie in die Natur, ohne zu wissen, was sie filmen werden und die Erzählung ergibt sich im Nachhinein?
Für ein Projekt wie das unsere kannst du nicht irgendwo hinreisen und zehn, zwölf nette Szenen drehen. Das erste, das du tun musst, ist dich für eine Erzählung zu entscheiden, die sich von Anfang bis Ende durchzieht. Da gibt es verschiedene Schritte. Wollen wir über die Zerstörung des Regenwaldes reden, müssen wir uns fragen: Welches Tier filmen wir dafür am besten? Orang-Utans. Dann folgt Schritt zwei: Orang-Utans wurden schon etliche Male gefilmt, was ist die neue Erzählung in unseren Aufnahmen? Erst dann folgt die konkretere Auswahl. Viele meiner Regisseure schreiben sogar ein Skript. Das Problem ist, dass die Tiere das nicht lesen – also schreiben wir es ständig um. Manchmal machen Tiere auch Dinge, die du so nie erwartet hättest. Das sind die schönsten Momente - wenn du Dinge filmst, die selbst Forscher so noch nicht beobachtet haben.
Wie weit darf man gehen, um die Erzählung aufrecht zu erhalten? Ist es in Ordnung, an Tag eins einen Eisbären zu filmen, an Tag zwei einen anderen und am Ende werden beide zu einer Geschichte zusammengefügt?
Es gibt sehr simple Regeln: Die Zuschauer erwarten von uns, dass wir zu hundert Prozent ehrlich sind. Das Verhalten der Tiere, das wir zeigen, ist immer korrekt, wahr und in keinem Fall konstruiert oder falsch. Bei vielen Tieren ist es möglich, sich an ein Individuum zu heften – mit der Orang-Utan-Mutter haben wir Monate verbracht. Willst du aber einen Tag im Leben einer Pinguinkolonie nacherzählen, ist es schwer einem Individuum zu folgen, da sind hunderte von denen. Einen Tag kannst du nacherzählen, indem du viele verschiedene begleitest und sie in dieselbe Erzählung schneidest - es ist wichtig, die Zuschauer in die Erzählung eines Charakters zu involvieren.
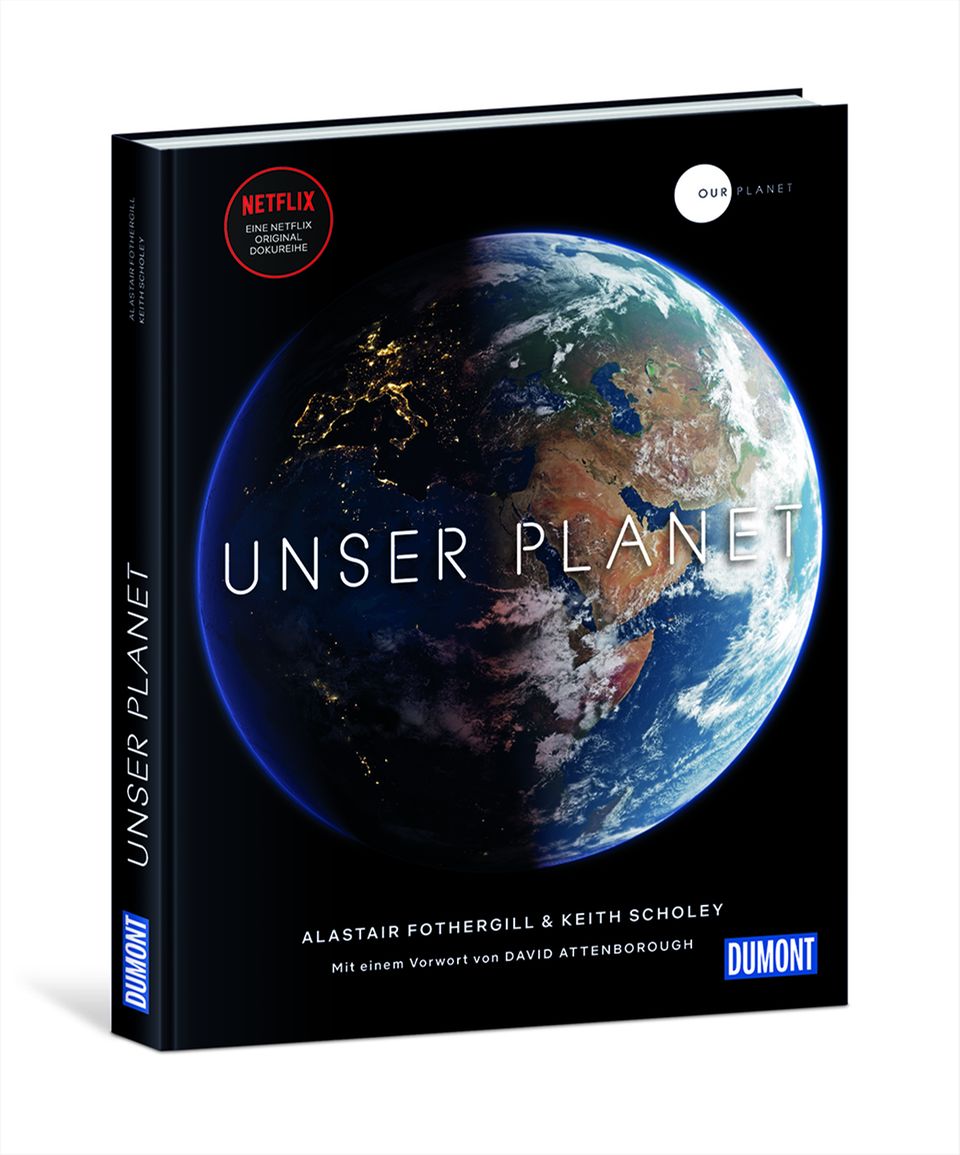
Nach all diesen Jahren hinter der Kamera: Können Sie die Natur überhaupt noch genießen oder sitzt da immer der Regisseur im Hinterkopf auf der Suche nach dem besten Bild? Wohin gehen sie ohne Filmteam?
Meine Liebe zur Natur hat sich nie verändert und wird es auch nicht. Wenn wir irgendwo drehen, passiert die meiste Zeit nichts. Wir sitzen in einem Landrover, am Strand oder einfach irgendwo und warten. Wir haben sehr viel Zeit, die Natur zu genießen, bis der Bär endlich aufwacht. Wir sitzen dort und beobachten – für mich ist das sehr besonders. Zuhause in Großbritanien ist mein Lieblingsort die Küste im Osten: fantastische, wilde Klippen voller Leben. Im Sommer kommen die Zugvögel aus Afrika zurück, ich liebe den unendlich weiten Himmel dort. Wenn ich an die Küste fahre, schaue ich immer erst, wann welche Gezeiten sind. Ich plane meinen Tag nach ihnen, weil sie bestimmen, wo ich hingehen und was ich sehen kann. Ich mag das, es löst ein bestimmtes Gefühl in mir aus: Die Natur hat mehr Kontrolle über den Lauf der Dinge als ich es habe.




























