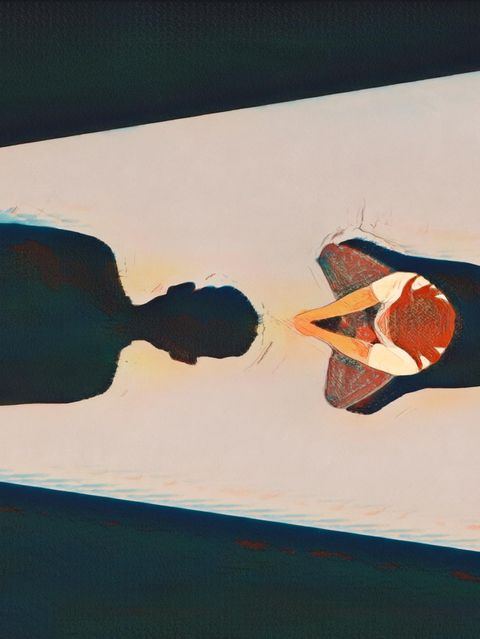Eine gute Idee, aber viel zu teuer - so lautete vor Jahrzehnten das Urteil über die "Transmutation" von hochradioaktivem Atommüll, die Umwandlung besonders gefährlicher Bestandteile aus alten Brennelementen zu harmloseren Stoffen. Damit verschwand die Transmutation als Beitrag zur Lösung des Atommüll-Dilemmas aus der öffentlichen Diskussion.
Aber nicht aus den Köpfen und Labors der Kernforscher. In den vergangenen 15 Jahren haben sie das Verfahren weiterentwickelt. Heute sind Physiker und Ingenieure wie Joachim Knebel vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) überzeugt, dass die Transmutation auch wirtschaftlich arbeiten würde. Demonstrieren wollen sie das in einer Pilotanlage im belgischen Mol. Bauzeit etwa zehn Jahre, geschätzte Kosten fast eine Milliarde Euro.

Die neue Technologie verfährt nach der Devise: Das schlimmste Problem zuerst anpacken. Beim Atommüll sind das die sogenannten Transurane; neue Elemente wie Plutonium, Americium, Neptunium und Curium, die im Reaktor entstehen. Obwohl sie nur ein Prozent der Masse in den abgebrannten Brennelementen ausmachen, sind sie extrem radiotoxisch und zerfallen sehr langsam. Ein paar Millionstel Gramm Plutonium in der Lunge reichen aus, um Krebs zu erzeugen. Und Plutonium-239, zum Beispiel, besitzt eine Halbwertszeit von 24 000 Jahren, strahlt also bis weit in eine unbestimmte Zukunft.
Um diese Transurane umzuwandeln, müssen sie zunächst vom restlichen Atommüll getrennt werden. Im Labormaßstab ist das bereits gelungen. Daraufhin werden die hochgefährlichen Stoffe in einer speziellen Anlage mit Neutronen beschossen und wandeln sich dabei um in kurzlebigere Elemente. Plutonium-239 etwa zerteilt sich unter dem Beschuss in Caesium-134 (Halbwertszeit zwei Jahre) und in das nichtradioaktive Ruthenium-104. Außerdem wird jede Menge Wärme frei. Diese könnte, etwa in einem Kernreaktor, profitabel zur Stromerzeugung genutzt werden.
"Unser Ziel ist es, 99,99 Prozent der gefährlichen Transurane umzuwandeln", sagt Knebel. Dann müsste Atommüll nicht mehrere 100 000 Jahre gelagert werden, sondern "nur" noch etwa 500 Jahre. Das Problem bekäme eine überschaubare Dimension. Den Müll unwiederholbar in einem Salzstock zu vergraben, wie zur Zeit noch geplant, erscheint angesichts dieser Forschung als die unsinnigste aller Lösungen des Atommüllproblems.