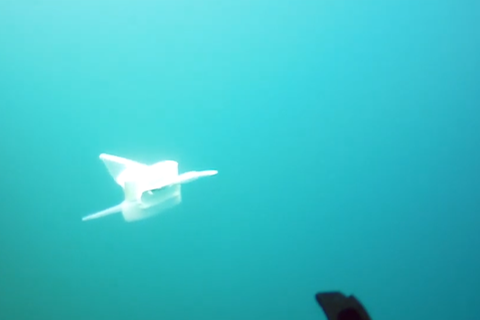Ihre Meinung ist gefragt: Was halten Sie von dem Konzept? Bitte nutzen Sie die Kommentarfunktion unten auf dieser Seite.
Was ist ein Traktor? Für Marcin Jakubowski eigentlich bloß ein Kasten mit vier Rädern, jedes angetrieben von einem Hydraulikmotor. Diese Einsicht kam dem 39-Jährigen, als der Schlepper auf seiner Farm in Missouri defekt war. Nach seiner Promotion hatte sich der Physiker von der akademischen Welt abgewandt, weil er sie zu abgehoben fand. Und weil er etwas mit den Händen machen wollte, kaufte er zwölf Hektar Land, baute Weizen an und bewirtschaftete eine Obstplantage. Nun benötigte er für die Ernte einen neuen Traktor. Schnell. Billig. In ein paar Tagen baute er einen Kasten mit vier Rädern und Motoren. Und dachte sich: „Wow, so einfach geht das.“ Das war der Anfang.
Könnte man so nicht auch andere Maschinen preiswert im Eigenbau herstellen? Eine Sägemühle? Einen Zementmischer? Jakubowski begann, über das große Ganze nachzudenken: Welche Hilfsmittel wären nötig, um von Grund auf eine nachhaltige Siedlung aufzubauen, irgendwo in der Welt? 50 Maschinen entstanden in den folgenden Monaten am Reißbrett. Simple wie ein Gerät für das Ausbringen von Saatgut, komplexe wie ein Laserschneidegerät. Dazu Bulldozer, Windturbine, Melkmaschine, Brunnenbohrer, ein Solarkonzentrator, der mit Sonnenwärme Dampf erzeugt. Alles zusammen bildet nun das „Global Village Construction Set“ (GVCS), wie Jakubowski sein Projekt nennt: Es ist eine Art lebensgroßer Lego-Baukasten, darin enthalten Technik für eine Siedlung, die modernen Lebensstandard ermöglicht. Fast überall auf der Welt ließe sich damit ein neues Dorf aufbauen; mit wenigen Mitteln.

Jakubowskis Idee gewann schnell Anhänger - und er Helfer, von denen einige zu ihm auf die Farm zogen. Briana Kufa etwa, 20, ausgebildete Schweißerin, unterbrach ihr Ingenieurstudium, um bei Jakubowski eine Presse zu entwickeln, die Ziegel aus Erde und Schlamm herstellt. Sie baute mit anderen Freiwilligen vier Exemplare und stellte eine Anleitung ins Internet.
Pro Presse lassen sich 5000 Ziegel täglich herstellen, das reicht für ein kleines Haus. Kommerzielle Erdziegelpressen sind etwas schneller, kosten aber Zehntausende US-Dollar; die Teile für Kufas Modell bekommt man für 1300 Dollar, das meiste im Baumarkt. Ein Achtel ihrer industriell gefertigten Pendants sollen die selbst gebauten Maschinen durchschnittlich kosten. Die Erfinder haben ihr Projekt inzwischen „Open Source Ecology“ getauft. „So wie bei Open-Source-Computersoftware Aufbau und Quellcode der Programme öffentlich zugänglich sind, möchten wir bei Open Source Ecology die Konstruktionspläne von Maschinen und Geräten offenlegen“, erklärt Nikolay Georgiev, ein 27-jähriger Informatiker im Team. Um Aufwand und Preis niedrig zu halten, werden Konstruktionen so gestaltet, dass sie oft durch kleine Umbauten mehrere Zwecke erfüllen können. Maschinen sollen außerdem durch wenige Änderungen ineinander überführbar sein: Die mit Wasserdampf aus dem Solarkonzentrator angetriebene Dampfmaschine etwa treibt einen Generator an, der wiederum Strom bereitstellt für die passenden Akkus von Auto und Traktor.
Die Vision ist ein Open-Source-Produktionslabor voller Anleitungen, mit denen jeder weltweit technischen Fortschritt verwirklichen kann, „kostengünstig, schnell und mit Ressourcen aus seiner Umgebung“. Auch in Afrika oder der Mongolei. Mithilfe der Baupläne könnten Siedlungen entstehen - ideal erscheint Jakubowski eine Größe von etwa 200 Personen -, die unabhängig vom Stromnetz sind. Das klingt spektakulär, nur: Wer sollte warum überhaupt komplett neue Dörfer bauen? An manchen entlegenen Orten würden Pioniere sicher gern eine ganz neue Siedlung in Harmonie mit der Umwelt gründen, glaubt Georgiev. Das zu ermöglichen, sei das Fernziel - angedacht, aber noch nicht bis zum Ende durchdacht. Sehr konkret aber könne schon heute der Eigenbau einiger zentraler Geräte wie Stromgenerator, Brunnenbohrgerät und Zementmischer manches bestehende afrikanische Dorf in eine modernere Zeit katapultieren. Und ein Do-it-yourself-Kleinstmähdrescher oder -Bagger manchen westlichen Agrarbetrieb vor dem Aus retten, dem für die Neuanschaffung das Geld fehlt.
„Dass wir diese elementaren Geräte allen zugänglich machen, stärkt das Selbstbewusstsein“, sagt Georgiev. Die Belohnung: Eigeninitiative, Gemeinschaftsgefühl, Spaß an der Arbeit. Inzwischen koordiniert das Jakubowski-Team von der Farm in Missouri aus Hunderte Unterstützer, überwiegend in den USA, vor allem Farmer und Ingenieure. Sie haben sich in Online-Gruppen zusammengetan, um an der Entwicklung von jeweils einer Maschine mitzuarbeiten. Langsam wird das Projekt auch über Fachkreise hinaus bekannt. 2011 sprach Jakubowski auf einer TED-Veranstaltung, einer renommierten Wissenschaftskonferenz, die auch beim Laienpublikum beliebt ist. Seither schnellt die Zahl der Spender in die Höhe, ebenso die der Helfer. Für vier von 50 Maschinen stehen die Baupläne inzwischen im Internet.
Und sie werden nachgebaut: Kürzlich etwa hat ein kanadischer Software-Entwickler begeistert gemeldet, dass er die Erdziegelpresse benutzt. Jeder Nachbau der Prototypen bedeutet zugleich Erprobung und Weiterentwicklung: In Regionen etwa, wo die eingeplanten Baumaterialien oder Einzelteile nicht ohne Weiteres zu bekommen sind, findet jemand vielleicht guten Ersatz, notiert das im Idealfall im öffentlichen Konstruktionslogbuch im Internet - und wird dort wieder von jemand anderem ergänzt. „Das Open-Source-Prinzip sorgt dafür, dass die Produkte selbst eine Art Evolution durchlaufen“, sagt Nikolay Georgiev, der sich komplett ehrenamtlich engagiert. Andere Mitglieder im Kernteam erhalten dank der gestiegenen Einnahmen durch Spenden und Förderungen etwas Geld und können es sich zumindest leisten, tatsächlich ihre ganze Arbeitszeit dem GVCS zu widmen. „Das bringt die Idee voran“, sagt Georgiev. Die eigentliche Arbeit, fügt er hinzu, leisteten aber all die Freiwilligen, die unentgeltlich am Bauen und Entwerfen der Maschinen tüfteln. Aus Bastellust, aus dem Bedürfnis, an etwas Großem mitzuarbeiten.
Georgiev selbst wohnt derzeit in Darmstadt und will für das Projekt in Europa werben, etwa unter Ingenieuren. Ziel bis Ende 2012 ist es, für alle 50 Maschinen Prototypen zu bauen. Das sei ambitioniert, sagt Georgiev, aber dank der wachsenden Beteiligung gar nicht so unwahrscheinlich
Nützliche Links
» Die Homepage des Projekts: opensourceecology.org
» Deutschsprachige Informationen finden sich auf osede.org.