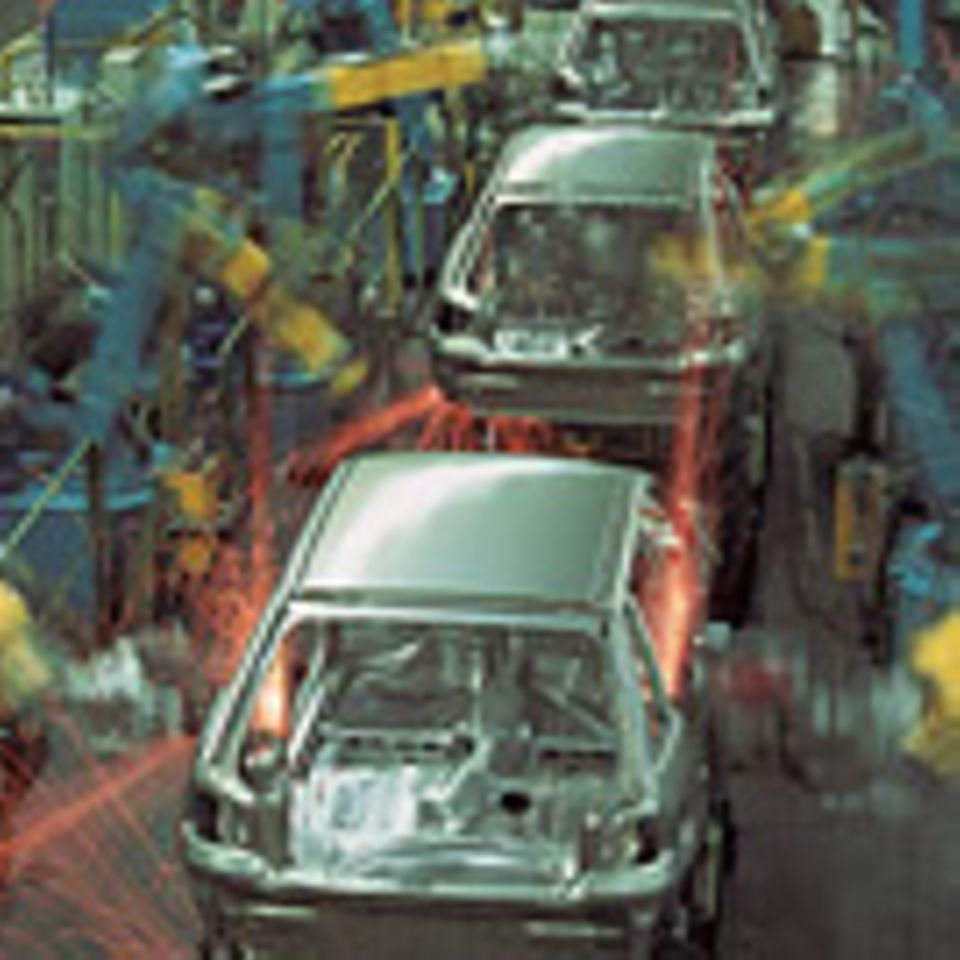Sind Ökonomie und Ökologie vereinbar? So oder so ähnlich lautet die Frage, die nicht erst seit dem Appell des Club of Rome im Jahr 1972 im Raum steht. Schon damals warnten Experten, unser Wohlstandsmodell und das Dogma vom ewigen Wirtschaftswachstum, auf dem es gründet, ruinierten auf lange Sicht unsere Umwelt.
Über 40 Jahre später scheint die Frage entschieden. In Deutschland wie in Brüssel fordern Regierung und Kommission einhellig mehr Wachstum - um Arbeitsplätze und Wohlstand zu sichern. Skeptikern, die einen direkten Zusammenhang etwa von Wirtschaftsaktivität und CO2-Emissionen sehen, begegnen sogar die Grünen mit der Idee von einem nachhaltigen, "grünem" Wachstum. Einem Wachstum, das nicht auf fossilen, sondern erneuerbaren Energien basieren soll. Das weniger Ressourcen verbraucht, das Wertschöpfung und Umweltzerstörung "entkoppelt".
Unterstützung erhalten die Green Growth-Apologeten nun von einer aktuellen Studie eines internationalen Expertenteams. Die Global Commission on the Economy and Climate veröffentlichte im September das Thesenpapier "Better Growth, Better Climate". In einem globalen Zehn-Punkte-Aktionsplan fassen die Autoren zusammen, wie aus ihrer Sicht Wachstum und Klima zugleich gerettet werden können - ohne das Wachstumsdogma selbst in Frage zu stellen. Empfohlen werden etwa klimaschonende Innovationen, ein Ausstieg aus der Kohleverstromung, ein Stopp der Waldabholzung.
Doch reicht das? Für Clive Spash vom Institut für Regional- und Umweltwirtschaft der Wirtschaftsuniversität Wien torpediert das Papier die "Notwendigkeit eines radikalen Wandels unserer politischen und wirtschaftlichen Systeme". In seiner Analyse kritisiert der Umweltökonom, die vorgebrachten Argumente seien ein Freibrief für ein komfortables Weiter-So. "Die Rhetorik suggeriert Besorgnis über den Klimawandel und die Armut, aber die Essenz ist business as usual in einer strukturell unveränderten politischen Ökonomie".
Unter anderem kritisiert Spash, dass der Rebound-Effekt kaum Berücksichtigung finde. Der Rebound-Effekt ist das scheinbare Paradox, dass trotz erhöhter Effizienz mehr Ressourcen verbraucht werden. Beobachten lässt sich das etwa an der Automobilindustrie. Die Antriebstechnologie wird zwar immer sparsamer. Allerdings werden auch immer mehr schwere, PS-starke Autos verkauft, wie die sogenannten SUVs. Das schmälert die Effizienzgewinne.
Für Niko Paech, einen der führenden deutschen Postwachstumsökonomen, ist grünes Wachstum schlicht ein Mythos. "Ganz gleich, ob es sich um Passivhäuser, Elektromobile, Ökotextilien, Photovoltaikanlagen, Bio-Nahrungsmittel, Offshore-Anlagen, Blockheizkraftwerke, Smart Grids, solarthermische Heizungen, Cradle-to-cradle-Getränkeverpackungen, Carsharing, digitale Services etc. handelt: Nichts von alledem kommt ohne physischen Aufwand, insbesondere neue Produktionskapazitäten und Infrastrukturen aus", schreibt Paech auf der Homepage des Leipziger Degrowth-Kongresses.
Auf Seiten der Green Growth-Apologeten reagiert man mittlerweile auf die Einlassungen der Postwachstumsökonomen genervt: So nannte einer der Co-Autoren der Studie, Lord Nicholas Stern, im Guardian-Interview die Wachstumskritiker "politisch sehr naiv". Wachstum auf der einen und Klima und Umwelt auf der anderen Seite gegeneinander auszuspielen sei "nutzlos wie ein Pinkelwettbewerb".