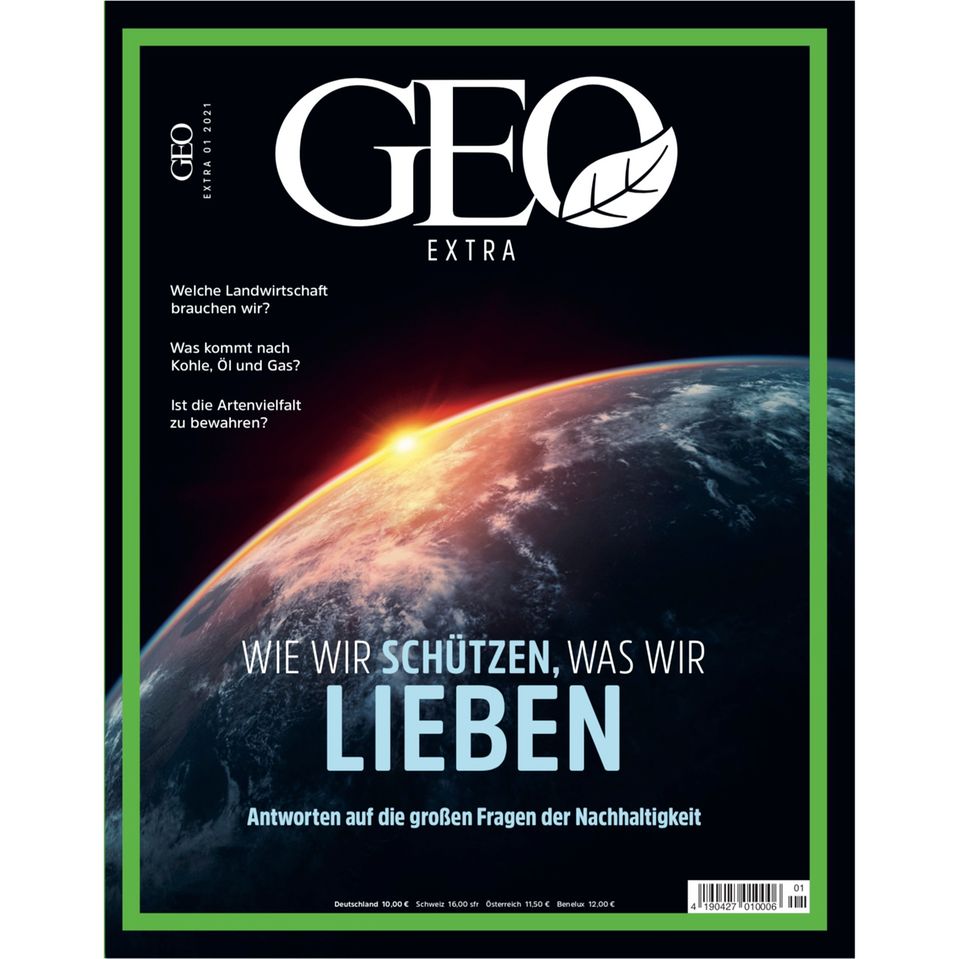AM SÜDBAHNHOF VON AMSTERDAM Am Südbahnhof von Amsterdam ist für Privatfahrzeuge Sackgasse. Aus welcher Richtung die Automobilität auch anrollt: Das Ende ist nah.
Daher fällt auf, selbst wenn man unmittelbar vor dem belebten Bahnhof steht, wie still es dort für einen lebendigen Großstadtknotenpunkt ist. Eine S-Bahn rollt nahezu geräuschlos ein, Elektrobusse schnurren davon, Radfahrer haben den großen Vorplatz und viele der umliegenden Straßen komplett für sich. Rund um den Bahnhof gibt es mehr als 9000 Fahrradstellplätze – unterirdisch und hochmodern. Eine Digitalanzeige leitet Radler auf sanften Rampen abwärts in die hellen, weitläufigen Garagen, die mit ihrem glänzenden Boden, weißen Säulen und futuristischer Deckenbeleuchtung eher an einen Luxus-Shop als an ein düster-muffiges Parkhaus erinnern.
Pendler, die mit der S-Bahn ankommen, werden zu einem „Mobilitäts-Hub“ geleitet; dort kann jeder mit einer einzigen App auswählen, womit sie oder er weiterfahren will: E-Bike, Lastenrad, Elektroroller oder Carsharing-Fahrzeug? Alle lassen sich innerhalb der App reservieren, buchen, entriegeln und bezahlen.
Sieht so die Zukunft der Mobilität aus?
Wer dem Berliner Zukunftsforscher Stephan Rammler zuhört, bekommt jedenfalls den Eindruck, dass sich bald grundlegend ändern wird, wie wir uns fortbewegen. „Wir befinden uns am Endpunkt einer etwa 100-jährigen Automobilgeschichte“, behauptet Rammler, wissenschaftlicher Direktor des Berliner Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung. Im Interview spricht Rammler so schnell, dass man das Gefühl hat, in seinem Kopf seien schon wieder zwei neue Gedanken fertig, wenn der alte gerade erst halb ausformuliert ist.
Das Ende des Autozeitalters ist also nah? Noch ist für viele Menschen in Deutschland der eigene Pkw der Goldstandard der Fortbewegung. Sie spulen mit ihm die meisten Kilometer ab und investieren in ihn das meiste Geld. Das eigene Auto wartet geduldig und wasserdicht vor der Haustür, bis uns das Fernweh packt oder die Kinder in die Schule müssen. Es verkörpert, in zwei Tonnen Stahl, die Leichtigkeit müheloser Mobilität.
Das Problem ist nur: Es sind viele, denen das Auto dies verspricht.
Mehr als 40 Millionen Autos in Deutschland, die im Jahr 1,4 Millionen Kilometer Stau bilden: Mobilität ist, was wir uns wünschen. Verkehr ist, was daraus wird. „Das alte Modell lautete: eine Familie, ein Haus, ein Auto“, führt Zukunftsforscher Stephan Rammler aus. „Doch für dieses Modell fehlen uns mehr und mehr die Ressourcen – vor allem der Platz und die fossilen Brennstoffe.“
Nachhaltig ist dieses alte Modell nicht. In der EU verursacht der Verkehr rund 30 Prozent der gesamten CO2-Emissionen; rund 60 Prozent davon entfallen auf das Auto. Während der Ausstoß in der Industrie, beim Wohnen oder bei der Energieerzeugung seit Jahren sinkt, steigen die verkehrsbedingten CO2-Emissionen. Dazu kommt: Bis zum Jahr 2050 werden zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben, mehr als sechs Milliarden Menschen. Schon heute ächzen die Metropolen unter der Last des Verkehrs, machen Enge, Lärm und Abgase den Stadtbewohnern das Leben schwer. Unnötig schwer: Denn längst gibt es Konzepte für nachhaltige Mobilität.

I. Das Sammelsurium
Die Zukunft der Mobilität ist, auf den ersten Blick, unübersichtlich.
Überall auf der Welt wurden in den vergangenen Jahren Pilotprojekte gestartet, die erlauben sollen, mehr Menschen nachhaltiger zu transportieren. Vor allem in Städten wird ein Sammelsurium von Ideen erprobt:
• In Singapur experimentiert die Stadtverwaltung mit der Vernetzung anonymisierter Daten, um den Verkehr der Millionenmetropole intelligent zu steuern. Singapur steht damit an der Spitze eines internationalen Rankings zur Zukunftsbereitschaft für urbane Mobilität (Amsterdam steht auf Platz 2, Berlin auf Platz 10).
• In Lissabon ließ der deutsche Autohersteller Volkswagen in einem Feldversuch Busse mithilfe von Quantencomputern effizienter durch den Verkehr steuern.
• In La Paz, Bolivien, und in Medellín, Kolumbien, überbrücken Seilbahnen große Höhenunterschiede im Stadtgebiet.
• Barcelona hat begonnen, komplette Stadtquartiere (supermanzanas) für den Autoverkehr zu sperren: Auf den einstigen Straßenkreuzungen treffen sich die Anwohner nun zu Yoga-Klassen. Die Verringerung der Abgasbelastung könnte, so kalkulieren Umweltmediziner, jährlich 3500 Todesfälle in der Region verhindern.
• In Shenzhen, China, sind gut 16000 Batterie- Busse unterwegs, bis Ende 2020 sollen alle Taxis elektrisch fahren.
• Der Flugzeugkonzern Airbus arbeitet an einem Flugtaxi ohne Pilot: Die „3-D-Mobilität“ soll helfen, die Enge am Boden zu überwinden.
• Der japanische Autohersteller Toyota plant am Fuß des Vulkans Fuji eine komplett nachhaltige Modellstadt („Woven City“) mit emissionsfreien, selbststeuernden Fahrzeugen.
Besonders in autonom fahrende Autos, also Fahrzeuge ohne Fahrer, setzen Stadtplaner große Hoffnungen: Solche Autos können, wenn ihre Computer miteinander kommunizieren, dichter hintereinander und nebeneinander fahren und brauchen daher weniger Platz im Stadtverkehr. Straßen werden, statt starren Linien zu folgen, fließend genutzt, mit kleinen, flinken, lautlosen Elektrofahrzeugen, die sich organisch wie Fische in einem Schwarm aneinander orientieren. Und autonom fahrende Kleinfahrzeuge und Minibusse könnten, weil sie ohne Personal auskommen, den öffentlichen Nahverkehr so individuell und günstig gestalten, dass das eigene Auto ein unnötiger, teurer Luxus wäre.

II. Erste Nadelstiche
Das autonom fahrende Automobil ist in Amsterdam noch eine Utopie.
Trotzdem ist in der Stadt eine Verkehrsrevolution im Gange – die nach und nach Fahrt aufnimmt. Zu jenen, denen es gar nicht schnell genug gehen kann, gehört Lucas Harms von der Dutch Cycling Embassy, einem Netzwerk von Fahrradaktivisten und öffentlichen Partnern mit einem kämpferischen Motto: „Unser Auftrag: Radfahren für alle“ – was auch wie ein Befehl klingen könnte. Doch wer mit Lucas Harms durch Amsterdam radelt – er trägt Multifunktionsjacke und den Hemdkragen offen –, hört von ihm kein böses Wort über Autos. Lucas Harms ist ein fröhlicher Fahrradfan, kein verbissener Aktivist.
Am Meester Visserplein, einer mehrspurigen Kreuzung in Amsterdams Zentrum, wo sich Autos, Fahrradfahrer, Motorroller und Fußgänger drängeln, deutet Harms auf das Dach eines der Eckhäuser: „Dort oben haben Verkehrsplaner der Universität Kameras angebracht, um das Verhalten der Menschen an der Kreuzung zu analysieren“, erklärt er. Dies führte zu zwei Neuerungen, die sich seither in ganz Amsterdam ausbreiten: der Pommestüte und der Banane.
Die Pommestüte (holländisch frietzak) mit ihrer spitz zulaufenden Form spielt auf die neue Form der Fahrradwege an, die über die Kreuzung verlaufen: sie beginnen breit und werden dann schmaler. „An einer roten Ampel stehen viele Radfahrer nebeneinander“, erklärt Harms. „Weil alle gleichzeitig losfahren, kamen sie sich früher in der Mitte oft in die Quere.“ Die neuen trichterförmig zulaufenden Radspuren führen dazu, dass sich die Fahrer an der Ampel zunächst nebeneinander aufstellen und bei der Überquerung der Straße sukzessive hintereinander einordnen, sodass Radler aus beiden Richtungen bequem aneinander vorbeifahren können.
Die „Banane“ wiederum beschreibt die Tatsache, dass moderne Radwege in den Niederlanden dicker werden, wenn sie um eine Kurve führen. „Auch hier hilft der zusätzliche Platz, wenn viele Radler an einer Ampel warten müssen. Außerdem zeigten die Kameras, dass die Radfahrer beim Abbiegen sowieso aus ihrer vorgegebenen Fahrbahn ausscheren, um besser um die Kurve zu kommen. Warum also nicht den Radweg in der Kurve gleich ein wenig breiter machen?“, sagt Harms.
Er nennt solche Neuerungen „Verkehrsakupunktur“, doch diese Nadelstiche basieren auf einer Heilslehre, die dabei ist, Städte weltweit umzukrempeln: der datengestützten Verkehrssteuerung und Stadtplanung. Denn noch nie zuvor wussten Stadtplaner so detailliert wie heutzutage, wie sich Menschen durch die Stadt bewegen. Früher saßen Schulkinder und Rentner auf Klappstühlen an den Straßenrändern, um Autos zu zählen. Heute erfassen Kameras und andere Sensoren, Mobiltelefone, Chipkarten in Echtzeit, wo sich Fußgänger ballen, wo Leihfahrräder fehlen oder Autos im Stau stehen.
In Amsterdam haben es intelligente Verkehrsleitsysteme geschafft, die Stillstandszeiten im Straßenverkehr um zehn Prozent zu reduzieren. So wird der Verkehr nachhaltiger, ohne dass man dabei auf Mobilität verzichten müsste. Daten können dabei helfen, mit weniger weiter zu kommen. Aber wie lässt sich die digitale Datenflut in sinnvolle Bahnen lenken?
III. Die Daten-Cowboys
Bisher sind vor allem Digitalfirmen aus den USA sehr gut darin, Datenschätze zu heben, die sich im urbanen Verkehr verstecken.
Beim Taxidienstleistungsunternehmen Uber, dessen Europazentrale in Amsterdam residiert, feilen weltweit Tausende Softwareentwickler an Algorithmen, die aus Buchungen, Wetterdaten und Veranstaltungskalendern immer präziser vorhersagen können, wie viele Fahrer demnächst in welcher Ecke der Stadt benötigt werden. Diese Daten stellen hier einen massiven Vorteil gegenüber der Konkurrenz dar.
Lizann Tjon ist das ein Dorn im Auge, „weil manche dieser Firmen nur sehr kurzfristige Ziele haben“. Die junge Frau leitet das städtische Ressort „Smart Mobility“, das nicht im Amsterdamer Rathaus untergebracht ist, sondern in einem Co-Working Space: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Laptops, die Atmosphäre soll auch qualifizierte junge Programmierer anlocken, denen ein Büro mit Gummibaum zu piefig ist.
Manche Mobilitätsfirmengründer bezeichnet Lizann Tjon als „Cowboys“: Sie kommen aus der Fremde in die Stadt geritten, und wenn ihnen das Geld ausgeht oder ihr Geschäftsmodell nicht funktioniert, verschwinden sie wieder. Und mit ihnen die Mobilitätsdaten, die sie gesammelt haben. Dabei wären diese auch für die Verkehrsplaner und den öffentlichen Nahverkehr immens wertvoll. „Viele Start-ups versprechen in ihren Powerpoint-Präsentationen, dass sie die Welt zu einem besseren Ort machen wollen“, sagt Tjon. „Ich glaube, wenn man für die Stadt arbeitet und gleichzeitig versteht, wie die Start-ups denken, kann man das deutlich besser und nachhaltiger – und ich habe inzwischen auch einige Kollegen, die deswegen von Start-ups zu uns gewechselt sind.“
Amsterdam setzt auf einen Mix aus strengen Gesetzen und individuellen Vereinbarungen. Auch der Taxidienst Uber gewährt der Stadt inzwischen Einsicht in bestimmte Daten. So lässt sich überprüfen, ob die Fahrer Verkehrsregeln und Ruhezeiten einhalten. Lizann Tjon erfährt aber auch, wo ein starker Bedarf an Fahrten herrscht und deshalb vielleicht das Nahverkehrsnetz ausgebaut werden sollte.

Dazu kommen all die Informationen, die an anderen Orten gesammelt werden. Die Polizei weiß, welche Kreuzung wegen eines Unfalls dicht ist; die öffentlichen Verkehrsbetriebe GVB wissen, wie pünktlich welche Trambahnlinie ist, die Taxiunternehmen, wo gerade Wagen fehlen.
„Die Stadt Amsterdam muss all diese Daten nicht unbedingt besitzen“, sagt Tjon. „Aber wir brauchen Zugriff darauf. Um sie zu analysieren, daraus zu lernen und letztlich Vorhersagen und Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können.“ Welche Straße wird täglich von deutlich mehr Radlern als Autos benutzt und sollte also in eine Fahrradstraße umgewandelt werden? Welche Buslinie könnte verlängert werden oder in höherer Taktung fahren? Wie lassen sich die stündlich an- und abschwellenden Verkehrsströme am besten lenken und leiten?
Aktuell arbeitet Tjon an einem Konzept, wie sich diese Daten zusammenführen lassen. „Wir wissen noch nicht, ob das zwangsläufig ein physischer Ort sein muss. Eine Schaltzentrale, an der all diese Daten auf einem großen Display an der Wand zu sehen sind. Vielleicht sind auch Webseiten, auf denen man sich aggregiert nur jene Daten anzeigen lassen kann, die man im konkreten Fall braucht, die bessere Lösung.“ Transparenz ist dabei wichtig: Bereits jetzt stellt die Stadt Amsterdam im Internet detaillierte interaktive Karten bereit: An welchen Stellen in der Metropole werden auf welche Art Verkehrsdaten erhoben? Welche Strecken eignen sich wie gut für Fußgänger? „Wir erfassen dabei ausschließlich die Anzahl der Menschen und keinerlei identifizierende Merkmale. Das ist uns wichtig“, sagt Lizann Tjon.
Auch in anderen Städten hat man verstanden, dass in digitalen Daten der Schlüssel zur mobilen Zukunft liegt. Eine Studie der texanischen Forschungseinrichtung A&M kam zu dem Ergebnis, dass Ampeln, die, statt in festgelegten Intervallen umzuschalten, auf Echtzeitdaten reagieren, die Wartezeiten um bis zu 40 Prozent reduzieren und den Durchsatz um bis zu 60 Prozent erhöhen können. Auch die Einhaltung von Verkehrsregeln kann durch Daten besser kontrolliert werden: Wer in Amsterdam mit einem Mofa oder einem Motorroller durch den beliebten Fahrradtunnel am Hauptbahnhof fährt, bekommt automatisch einen Strafzettel – sein Kennzeichen wurde von einer Kamera erfasst und digital ausgelesen. In Kalifornien überwacht ein Bilderkennungsalgorithmus, ob sich ein allein im Auto sitzender Fahrer auf die Spur mogelt, die für hochausgelastete Fahrzeuge reserviert ist. Mit einer 95-prozentigen Trefferquote schlägt das System menschliche Kontrolleure um Längen.

IV. Smartphones helfen
Auch im öffentlichen Nahverkehr werden Daten immer wichtiger.
In immer mehr Städten von Amsterdam über London bis Hongkong werden statt klassischer Papiertickets, aus denen sich kaum Informationen generieren lassen, Smartcards verwendet. Diese müssen beim Ein- und Aussteigen an ein Lesegerät gehalten werden. Dadurch wird nicht nur der Fahrpreis berechnet und abgebucht, sondern die Verkehrsbetriebe erhalten auch viel detailliertere Informationen darüber, wie viele Menschen wann wohin fahren, wo sie umsteigen und wie lange sie unterwegs sind. Eine tägliche Verkehrszählung in Echtzeit.
Für das sogenannte Ride-Pooling sind digitale Daten sogar unverzichtbar – Anbieter wie Moia in Hamburg und Hannover, Berlkönig in Berlin oder Clevershuttle in Düsseldorf, Leipzig und Kiel bieten geteilte Taxifahrten an: Wer eine Fahrt mit dem Smartphone bucht, wird mit anderen Fahrgästen, die in etwa dieselbe Strecke fahren wollen, gemeinsam befördert. Das System teilt dem Fahrer permanent mit, wen er wann wo einzusammeln und abzusetzen hat. Ohne digitale Daten und eine kontinuierliche Routenoptimierung wäre so ein Dienst – flexibler als die starren Nahverkehrsrouten, ökologischer als Einzelfahrten – nicht denkbar.
„Erst durch das Smartphone wird es möglich, Verkehrsmittel auch sinnvoll zu teilen“, sagt Mobilitätsexperte Stephan Rammler. „Auch multi- und intermodale Mobilität bekommt durch das Smartphone den nötigen Schub.“
Multimodal bedeutet, dass Menschen nicht immer dasselbe Verkehrsmittel benutzen, sondern zum Beispiel bei schönem Wetter mit dem Fahrrad ins Büro fahren, bei schlechtem mit dem Bus. Intermodale Mobilität meint, dass für eine Fahrt mehrere Verkehrsmittel kombiniert werden: mit dem eigenen Fahrrad zur S-Bahn und am Zielbahnhof mit dem Leihroller die letzten Meter ins Büro. Doch was ist die beste Kombination? Fährt die S-Bahn pünktlich? Ist ein Leihroller verfügbar? Oder wäre es besser, gleich die komplette Strecke zu radeln? Wenn die richtigen Daten zur Verfügung stehen, beantwortet das Smartphone diese Fragen in Sekunden.
Stephan Rammler warnt jedoch davor, Mobilitätsdaten ausschließlich großen Unternehmen zu überlassen: „Datenreichtum ist extrem wichtig für das Management von hochkomplexen Verkehrsflüssen“, sagt er. Mehr Daten erlauben bessere Dienstleistungen, was mehr Nutzer anlockt und noch mehr Daten generiert. „Wenn wir erlauben, dass Konzerne wie Google, Uber oder auch die deutschen Autobauer Daten sammeln, die der kommunalen Verkehrsplanung nicht zugänglich sind, dann werden diese Firmen am Ende immer Konkurrenzvorteile haben.“ Städte sollten es deshalb zur Bedingung machen, dass Anbieter, die in ihrem Gebiet tätig sein wollen, ihre Daten mit der örtlichen Verkehrsplanung und den öffentlichen Nahverkehrsanbietern teilen.
Die Politik hat den Wert des digitalen Rohstoffs erkannt: Eine EU-Verordnung verpflichtet Mobilitätsanbieter seit Dezember 2019, „Reise- und Verkehrsdaten über einen Nationalen Zugangspunkt (...) zugänglich zu machen“. In Deutschland betreibt das Verkehrsministerium mit der Plattform MDM („Mobilitäts Daten Marktplatz“) den Nationalen Zugangspunkt, auf dem nach und nach immer mehr Verkehrsdaten der Allgemeinheit zur Verfügung stehen sollen. Im Idealfall ermöglicht dies die Entstehung neuer oder besserer Dienstleistungen, Apps, Onlinekarten oder Routenplaner.

V. Corona ändert alles
Fortschritte gelingen nur schrittweise, und die Sehnsucht nach radikalen Lösungen ist groß. Wäre es zum Beispiel nicht viel einfacher, den öffentlichen Nahverkehr komplett kostenlos zu machen? Interessanterweise zeigen Pilotversuche, dass das kaum funktioniert: Ob im bayrischen Aschaffenburg oder im estnischen Tallinn – es steigen fast immer dieselben Menschen in den Gratis-Bus, die vorher dafür bezahlt haben. Sie nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel dann etwas häufiger, und es gesellen sich ein paar ehemalige Radfahrer und Fußgänger dazu.
Doch Autofahrer, so Studienergebnisse und Verkehrsexperten, steigen kaum um, wenn der ÖPNV kostenlos ist. Sie wechseln erst dann, wenn Autofahren und Parken teurer und mühsamer und gleichzeitig die Pünktlichkeit und Taktung des ÖPNV verbessert werden. Auch dafür braucht es digitale Echtzeitdaten: Sie können signalisieren und nach einer Weile sogar prognostizieren, wann eine U-Bahn so ausgelastet ist, dass zwei zusätzliche Waggons sinnvoll sind. Oder sie können in einer App anzeigen, wo sich der Bus, auf den man wartet, gerade befindet – und gegebenenfalls eine schnellere Alternative vorschlagen.
Auch hier spielen die Hubs, jene Knotenpunkte in der vernetzten Mobilität, eine wichtige Rolle. In Amsterdam gibt es neben den öffentlichen Hubs, etwa am Bahnhof, inzwischen auch kleinere, beispielsweise für Mietshäuser oder Wohnsiedlungen. Hier können die Anwohner gemeinsam festlegen, ob die Station mit mehr Lastenfahrrädern oder Sharing-Autos ausgestattet werden soll. Mobility as a Service (MaaS) heißt das Prinzip, also Mobilität als flexible Dienstleistung, die man je nach Bedarf in Anspruch nimmt. Das ersetzt den klassischen Fünfsitzer-Pkw in Privatbesitz, der in 95 Prozent der Zeit ungenutzt herumsteht und öffentlichen Raum belegt – und selbst wenn er fährt, im Durchschnitt nur 1,4 Personen transportiert.
Ökologisch gesehen ist der beste Weg naturgemäß jener, der gar nicht zurückgelegt wird. Denn selbst Elektromobilität und Fahrrad verursachen Umweltkosten. Wer verkehrsbedingt Emissionen vermeiden will, muss zu Hause bleiben. Was also geschieht, wenn tatsächlich auf einmal fast alle zu Hause bleiben?
Im Frühjahr 2020 kam die Mobilität weltweit zu einem Stillstand, den niemand vorhergesehen hatte. Auf dem Höhepunkt der Covid-19-Pandemie, mit nationalen und regionalen Lockdowns, brach der Verkehr tageweise auch in Deutschland um mehr als 80 Prozent ein. In Deutschland gingen die CO2-Emissionen im Monat April um sagenhafte 26 Prozent zurück, weltweit um 17 Prozent (und waren damit auf dem Stand, der 2006 noch Durchschnitt war).
Während in den Krankenhäusern Ärzte und Schwestern um das Überleben ihrer Patienten rangen und Millionen zu Hause saßen, um sich im Schnellkurs die Werkzeuge für Videokonferenzen und Heimarbeit anzueignen, veränderten sich die Städte weltweit. Im nordindischen Jalandhar konnten Menschen zum ersten Mal die Berge des knapp 200 Kilometer entfernten Himalaya-Gebirges sehen, die seit Jahrzehnten hinter einem Schleier aus Abgasen verborgen waren. Auf den Straßen New Yorks kehrte eine Ruhe ein, die vielen Bewohnern so gespenstisch erschien, dass die „New York Times“ auf ihrer Website Klangbeispiele vom Straßenlärm vor der Pandemie abspielte – das Hupen der Autos, das Fluchen der Taxifahrer wurde vermisst.
In Deutschland zeigen Untersuchungen, dass die Pandemie zuerst einmal dazu führte, dass vor allem Städter mehr zu Fuß unterwegs waren. Als die Innenstädte wieder öffneten, verzeichneten Fahrradläden einen Boom. Auch der Autoverkehr nahm schnell wieder zu, aber nicht bei Sharing-Angeboten. Der große Verlierer war der öffentliche Nahverkehr: Weil Millionen zu Hause blieben und die, die ins Büro mussten, sich im eigenen Auto wohl sicherer fühlten, gondelten halb leere Busse, halb leere Bahnen durch die Straßen. Unter Besserverdienenden sank die Quote der Fahrten im ÖPNV von acht auf zwei Prozent.
Welche langfristigen Auswirkungen die Pandemie auf den Verkehr haben wird, ist schwer abzuschätzen. Die Unternehmensberatung Accenture hat bereits „ein Jahrzehnt des Zuhause“ vorhergesagt, mit mehr Homeoffice und Homeshopping. Einige Großfirmen sehen, überrascht über die oft reibungslose Umstellung auf Fernarbeit, nun die Chance, radikal Bürofläche abzubauen: In Betrieben, in denen ohnehin 90 Prozent der Mitarbeiter am Computer tätig sind, erscheint es nach Monaten im Homeoffice sinnlos, jeden Morgen die ganze Belegschaft in einem Büroturm zu versammeln. Oder Führungskräfte auf Dienstreisen zu schicken. Statt uns selbst werden künftig wohl immer öfter unsere Daten unterwegs sein, in Videochats und virtuellen Konferenzen. Wir werden eher per Daten als per Straßennetz verbunden sein.
Einige Städte verwirklichten während der Pandemie Konzepte, die vorher nur Gedankenspiele gewesen waren: In der drangvollen Enge Manhattans wurden Straßenzüge für die Freiluftgastronomie gesperrt; in Berlin schufen Pop-up-Fahrradwege, für die ein Stück Straße abgetrennt und für Autos gesperrt wurde, Platz für die vielen Radler, die plötzlich unterwegs waren. Wenn es um die Mobilität in den Städten geht, geht es offenbar immer auch um die Frage: Wem gehört der öffentliche Raum? Auch in Amsterdam musste das heute so fortschrittliche Mobilitätskonzept hart erkämpft werden.

VI. Ein Ausblick
Letztlich ist die Frage nach der Zukunft der Mobilität in vielen Fällen ein Verteilungskampf.
Und wie so oft in der Geschichte ist es keine echte Revolution, wenn niemand etwas verliert. In Amsterdam werden zahlreiche Autospuren zu Fahrradwegen umgewandelt und binnen fünf Jahren weitere 11000 Autoparkplätze abgeschafft. Die verbleibenden sollen noch teurer werden, als sie ohnehin schon sind. Das stößt nicht immer auf Gegenliebe: In einigen Vierteln fürchten Einzelhändler um ihre Kundschaft, wenn deren Autos nicht mehr direkt vor dem Laden parken können. Oder Anwohner haben Angst, dass ein fahrradfreundlicheres Viertel mehr Gutverdiener anzieht und dadurch die Mieten noch schneller steigen.
Ein Stadtviertel, in dem sich dieser fortdauernde Verteilungskampf gut beobachten lässt, ist Amsterdams ehemaliges Arbeiterviertel De Pijp. 1972 dominierten hier noch die Autos, doch die Anwohner setzten sich zur Wehr, wie Filmaufnahmen von damals zeigen, auf denen sich ein Lieferwagenfahrer mit Demonstranten prügelt, die eine Straßenzufahrt blockierten. Fast 50 Jahre später ist das Video von der Blockade im Internet zu sehen, doch das Stadtviertel, das damals im Autoverkehr erstickte, hat sich grundlegend gewandelt: Die meisten Straßen sind einspurig. Dort, wo früher Autokolonnen am Straßenrand parkten, blühen heute Stockrosen. Auf Flächen, die früher zwei Autos einnahmen, bieten heute Fahrradständer jeweils rund 20 Rädern Platz. Nur vereinzelt gibt es noch ausgewiesene Autoparkplätze auf den Straßen: für Menschen mit Behinderung oder kurzzeitig für Lieferfahrzeuge.
Die Straßenschlacht von 1972 scheint also zugunsten der Radfahrer und Fußgänger ausgegangen zu sein. Doch sie zeigt auch, dass Amsterdam als lebenswerte Fahrradstadt von den Bürgern eingefordert, erkämpft und dann von der Stadt strategisch geplant wurde. Auf der Straße Plantage Middenlaan, die am Botanischen Garten vorbeiführt, teilten sich früher Straßenbahn und Autos 80 Prozent der Fläche. Heute fährt dort nur noch die Straßenbahn; ihre Gleise verlaufen nicht mehr über Asphalt, sondern auf einem breiten Rasenstreifen. Links und rechts davon bieten geräumige Radwege Platz, und statt geparkter Autos säumen Bäume und Blumenbeete den Straßenrand.
In Zukunft müssen solche Verteilungskämpfe vielleicht nicht mehr mit Wut im Bauch geführt werden: Daten können den Weg weisen, wo der Autoverkehr weichen kann, ohne dass die Mobilität darunter leidet.
Und wie lange wird das alles dauern? Der Automobilclub ADAC schätzt, dass sich erst in den 2030er Jahren teilautonome Autos verbreiten werden und noch 2050 Autos mit Fahrer die große Mehrheit stellen. Carsharing nimmt zwar zu, doch stehen in Deutschland gut 25000 Leihfahrzeugen knapp dreieinhalb Millionen jährliche Pkw-Neuzulassungen gegenüber, wovon mehr als 98 Prozent traditionelle Verbrenner sind.
Immerhin boomt der Fahrradverkauf seit Jahren, doch ob dies zu einer deutlichen Verschiebung der Mobilität führen wird, muss sich zeigen; die Umsatzzuwächse sind auch darauf zurückzuführen, dass E-Bikes deutlich teurer sind.
Heißt das, eigentlich bleibt alles beim Alten?
Lizann Tjon, die in Amsterdam den Bereich „Smart Mobility“ leitet, neigt nicht zu überbordendem Optimismus: Im Interview redet sie vorsichtig und mit Bedacht, diplomatisch und abwägend. Sie wirkt immer ein wenig auf der Hut, scheint nicht zu viel versprechen zu wollen, relativiert deshalb oft, schränkt ein. Doch sie hat ein klares Bild vor Augen, wie ihre Stadt in 20 Jahren aussehen wird.
Auf den Amsterdamer Straßen werden 2040 vor allem kleine autonome, elektrische Shuttles fahren, glaubt Tjon. Waren werden über Wasserwege und durch die Luft transportiert. Öffentliche Verkehrsmittel wie Bus, Zug und Straßenbahn und kleinere Fortbewegungsmittel wie Fahrräder oder Roller für die letzte Meile sind perfekt integriert. Alles wird über Apps gesteuert, und sowohl die Hubs, an denen die Verkehrsmittel bereitgestellt werden, als auch die Straßen selbst werden „smart“, können miteinander und mit den Nutzern kommunizieren. Und natürlich werden weniger Menschen mit Privatautos unterwegs sein, und es wird schnellere Zugverbindungen geben.
Es ist eine Stadt, wie sie bisher erst auf kühnen Computerskizzen zu sehen ist: ohne stinkende Staus, dafür mit viel Platz für die Menschen, die in ihr leben. Ein Ort, auf den man sich freuen kann.
Fazit des Autors: „Eine Sache hat sich durch meine Recherche verändert: Ich will nicht länger Fahrradmuffel sein. Egal, mit wem ich sprach, ob in Amsterdam oder Berlin – alle waren sich einig, dass das Verkehrsmittel der Zukunft nicht die wasserstoffbetriebene Drohne ist, sondern das gute, alte Fahrrad.
Meines stand bisher meist ungenutzt im Keller. Ich schiebe meine Unlust auf den brutalen Autoverkehr und mangelnde Radwege. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich bisher lieber in der Tram saß und ins Smartphone glotzte. Nach meiner Rückkehr aus Amsterdam griff ich aber beherzt zur Luftpumpe.
Überrascht hat mich bei meiner Recherche, dass Amsterdam gar nicht immer die Fahrradstadt war, als die es heute bekannt ist. Das zeigt, dass tiefgreifende Veränderung nicht einfach, aber möglich ist. Es gab Zeiten, da fuhren Autos durch die Torbögen des Rijksmuseums. Heute befindet sich dort, wo früher eine Straße auf das Gebäude zuführte, ein Park, die Passage teilen sich Fußgänger und Radfahrer. Oft nutzen Musiker die gute Akustik der Durchfahrt für Konzerte.“