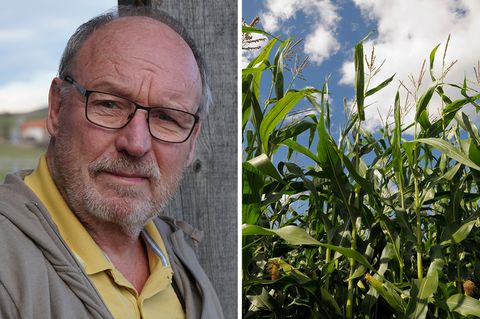114 Euro: So viel zahlt jeder Bürger der Europäischen Union jährlich für die Landwirtschaft in der EU. Mit insgesamt fast 60 Milliarden Euro ist der Topf für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) einer der größten aller EU-Töpfe – und der wichtigste Politikbereich der Union.
Doch wofür wird das Geld eigentlich ausgegeben? Und was bewirkt es? Umweltverbände beklagen seit langem, dass die Brüsseler Subventionspolitik nicht für einen ausreichenden Umwelt- und Klimaschutz sorgt, dass sie die Vielfalt auf dem Acker ruiniert – und den Trend des Höfesterbens weiter befeuert. Und das gegen den immer deutlicher artikulierten Wunsch vieler EU-Steuerzahler nach mehr Umwelt- und Tierschutz in der Landwirtschaft und dem Erhalt von kleinbäuerlichen Betrieben, Arbeitsplätzen und attraktiven ländlichen Räumen.
Das zeigt der soeben erschienene Agraratlas 2019, den die Heinrich-Böll-Stiftung gemeinsam mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und „Le Monde diplomatique“ herausgegeben hat.
Zahl der Höfe seit den 90er-Jahren halbiert
Demnach ist die Zahl der Betriebe in Deutschland seit Mitte der 1990er-Jahre um die Hälfte geschrumpft. Ein Drittel der Arbeitsplätze in der Landwirtschaft gingen verloren.
Eine Entwicklung, von der auch alle übrigen EU-Länder betroffen sind: In einem Zeitraum von nur zehn Jahren, zwischen 2003 und 2013, sind EU-weit ein Drittel aller Bauernhöfe verschwunden. Fast alle dieser Betriebe bewirtschafteten weniger als zehn Hektar – und waren damit zu klein zum Überleben: Ihre Erträge deckten – wegen der anhaltend niedrigen Lebensmittelpreise – kaum die Kosten der Produktion.
Ihre Flächen übernahmen meist größere Betriebe. Die Hälfte des kompletten Agrarlandes der EU wird heute von drei Prozent aller Betriebe bewirtschaftet. Die Folgen: Verlust von Arbeitsplätzen, intensive Produktionsmethoden, weniger Produkt- und Artenvielfalt auf dem Acker.
EU-Subventionspolitik schadet den Kleinen
Schuld an dieser Entwicklung, so die Autoren, seien nicht zuletzt die Direktzahlungen an die Landwirte aus der sogenannten ersten Säule. 70 Prozent dieser Gelder sind direkt an Flächen gekoppelt. Wer viel hat, bekommt also viel. Das steigert den Anreiz, zu wachsen – also etwa Flächen von kleineren Betrieben aufzukaufen, die aufgeben mussten.
Zwar erhalten seit der letzten Reform der GAP im Jahr 2013 auch kleinere Betriebe mehr Geld. Doch reiche das nicht aus, um das Höfesterben aufzuhalten.
Nach den beiden Weltkriegen sollte die GAP vor allem dafür sorgen, die notleidende Bevölkerung mit ausreichend günstigen Lebensmitteln zu versorgen. Dieses Ziel habe sie erreicht, schreiben die Autoren. Doch nun sei es an der Zeit, sie an den Wünschen der EU-Bürger nach mehr Tier- und Umweltschutz auszurichten – und den Trend zu immer größeren Betrieben zu stoppen.
Alle sieben Jahre wird die EU-Agrarpolitik neu justiert, das nächste Mal im Jahr 2021. Die schädlichen Direktzahlungen stehen allerdings nicht zur Disposition. "Seit vielen Jahren ignorieren die Regierungen der EU-Mitgliedsländer nicht nur die Forderungen großer Teile der Bevölkerung, sondern vertreten die Interessen der industriellen Agrarlobby in Brüssel", schreiben die Herausgeber in ihrem Vorwort. Die EU verfehle damit selbst gesteckte Ziele, etwa den Schutz von Klima, Böden und Gewässern und der Artenvielfalt, aber auch globale Gerechtigkeit, die nachhaltige Nutzung von Ressourcen und einen fairen Außenhandel.