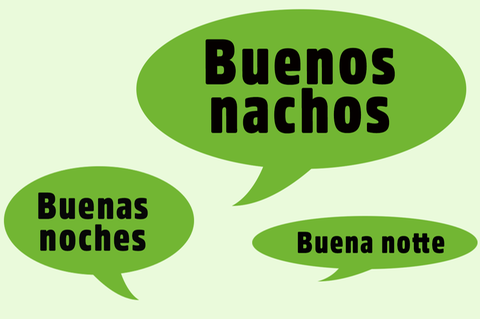711–1212: Der Kampf gegen die Mauren
Im Jahr 711 setzt ein Heer von mehreren Tausend Berbern aus Afrika nach Spanien über. Innerhalb weniger Jahre nehmen sie nahezu die gesamte Iberische Halbinsel ein, die ab Mitte des 8. Jahrhunderts unter der Befehlsgewalt des Emirs, später des Kalifen von Córdoba steht.
Damit beginnt die Blütezeit von al-Andalus – des iberischen Maurenreiches. Córdoba wird mit mehr als
100 000 Einwohnern zu seiner bedeutendsten Metropole; Wissenschaft, Dichtung und Architektur florieren.
Der Sieg in der Schlacht von Covadonga im Norden der Halbinsel ist um 722 der Beginn des christlichen Widerstandes gegen die Mauren, der reconquista („Wiedereroberung“). In der Nordregion, die so von der muslimischen Invasion ausgenommen bleibt, bildet sich mit dem Königreich Asturien ein Machtzentrum heraus, von dem aus die Christen langsam nach Süden vordringen.
Im Jahr 801 erobert ein Sohn Karls des Großen im Nordosten Gebiete, die den Kern des späteren Katalonien bilden.
In den folgenden Jahrhunderten entstehen im Norden mit Navarra, León, Kastilien und Aragón mehrere christliche Herrschaften. Sie gewinnen gegenüber den Muslimen nach und nach an Stärke – vor allem, als innere Unruhen 1031 zum Zerfall des Kalifenreiches in zahlreiche kleinere Herrschaften, die „Taifa-Reiche“, führen.
Die seit 1086 aus Nordafrika nach Spanien drängende Berberdynastie der Almoraviden aber stoppt das Vordringen der Reconquista. Da zudem die Kreuzzugsidee im christlichen Spanien immer stärker wird, eskaliert der Konflikt. So werden 1128, nach Jahrhunderten der Koexistenz, alle Christen aus al-Andalus ausgewiesen, später auch die Juden.
Bald darauf, ab 1146, verdrängen die noch radikaleren Almohaden die Almoraviden. Allerdings fällt ihnen die innere Befriedung ihres Reiches schwer, und im Kampf gegen die Christen gelingt es ihnen trotz einiger militärischer Siege nicht, deren Vormarsch zu verhindern. In der entscheidenden Schlacht von Las Navas de Tolosa, der größten des Mittelalters, schlägt König Alfons VIII. von Kastilien im Jahr 1212 die Almohaden vernichtend.
Deren Herrscher, Kalif Mohammed al-Nasir, flieht nach Marrakesch, sein Reich zerfällt. Nun dringen die christlichen Truppen rasch nach Süden vor und besetzen innerhalb von vier Jahrzehnten Córdoba, Jaén und Sevilla.
Lediglich in Granada kann sich bis 1492 die maurische Dynastie der Nasriden halten, da sie Kastiliens König als Lehnsherrn anerkennen.

1212–1516: Die Entstehung des spanischen Königreiches
Drei Herrschaften dominieren in diesen drei Jahrhunderten den christlichen Teil der Halbinsel. Im Westen ist aus einer zu León gehörenden Grafschaft das Königreich Portugal entstanden. Im Osten greift Aragón, mittlerweile mit Katalonien verbunden, zunehmend auf das Mittelmeer aus. 1282 akzeptiert Peter III., seit 1276 auf dem aragonischen Thron, die ihm von den Adeligen der Insel angetragene Krone Siziliens. 1442 erobert ein Nachfolger Peters das Königreich Neapel und damit ganz Süditalien. Zur größten iberischen Landmacht aber entwickelt sich Kastilien (seit 1230 mit León verbunden), das vom 11. Jahrhundert an nach und nach den größten Teil der früheren maurischen Herrschaftsgebiete annektiert.
Die Kronen von Aragón und Kastilien werden 1469 durch die Heirat Isabellas, der Halbschwester des kastilischen Monarchen, und des aragonischen Kronprinzen Ferdinand vereinigt. Als ihr Halbbruder 1474 stirbt, erklärt sich Isabella zur Königin. 1479 tritt Ferdinand nach dem Tod seines Vaters die Herrschaft in Aragón an. Die Reiche bleiben aber weiterhin getrennt und sind nur über die Ehe ihrer Herrscher verbunden.
Einzige gemeinsame Behörde ist die seit 1478 von den Königen kontrollierte Inquisition. Das zuvor rein kirchliche Glaubensgericht soll die religiöse Einheit der Reiche sicherstellen und dient den Herrschern als politisches Machtinstrument. In den ersten Jahren ihres Bestehens agieren die Richter der Inquisition vor allem gegen zum Christentum konvertierte Juden; bis 1490 verhängen sie bis zu 2000 Todesurteile.
Der erste Schritt zur äußeren Konsolidierung der zwei miteinander verbundenen Reiche ist die Eroberung Granadas. 1491 stehen die Truppen Ferdinands und Isabellas vor der Hauptstadt des letzten in Spanien verbliebenen muslimischen Reiches und belagern sie.
Emir Abu Abdallah, genannt Boabdil, beschließt zu verhandeln, lässt sich von den Königen das Recht auf freie Religionsausübung sowie den Fortbestand des maurischen Rechts für die islamische Bevölkerung zusichern und übergibt daraufhin die Stadt am 2. Januar 1492 an die Christen. Der Emir geht 1494 nach Marokko, wo er 1533 stirbt. Das Reich Granada wird Kastilien zugeschlagen, mehr als 700 Jahre maurischer Herrschaft finden ein Ende.
Wenige Wochen später befehlen die Könige die Ausweisung der in Spanien lebenden Juden; damit wollen die Monarchen die religiöse Einheit auf der Iberischen Halbinsel festigen. Der Vereinheitlichung ihrer Herrschaftsgebiete dient auch die 1492 erstmals erschienene kastilische Grammatik – weshalb 1492 als Geburtsjahr der modernen spanischen Sprache gelten kann.
Ferdinand und Isabella bauen die Macht aus und konsolidieren ihr Reich. So bringen sie unter anderem die einflussreichen Ritterorden unter ihre Kontrolle und setzen gegenüber dem Papst immer häufiger eigene Kandidaten für Bischofsämter durch. Und: Sie finanzieren dem genuesischen Seefahrer Christoph Kolumbus drei Schiffe, mit denen er einen Seeweg nach Indien über den Atlantik finden will.
Isabella stirbt 1504. Die Krone Kastiliens steht ihrer Tochter Johanna zu, doch die zeigt Anzeichen einer psychischen Erkrankung. Deshalb wird sie zunächst von ihrem Vater Ferdinand II. und nach dessen Tod 1516 auch von ihrem Sohn Karl isoliert und von der Politik ferngehalten.
Karl I., der Sohn Johannas und des bereits 1506 verstorbenen Habsburgers Philipp des Schönen, vereint die Kronen Kastiliens (einschließlich Navarras) und Aragóns auf sich und regiert damit als erster König ganz Spanien.
Karl verlässt Spanien, als sein Großvater Kaiser Maximilian I. stirbt und ihm damit auch das habsburgische Erbe zufällt. Er lässt sich zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation krönen und herrscht als Karl V. über ein Imperium, in dem Spanien nur ein Reichsteil unter vielen ist.
zurück zur Hauptseite
1492–1532: Die Eroberung Lateinamerikas
Schon bald nach der Rückkehr des Christoph Kolumbus aus Amerika streiten Spanien und Portugal über die Besitzrechte an den neuen Territorien. Papst Alexander VI. spricht die Gebiete 1493 Spanien zu. Im folgenden Jahr einigen sich beide Staaten im Vertrag von Tordesillas darauf, dass alle Gebiete rund 2000 Kilometer westlich der Kapverden an Spanien, alle Gebiete östlich dieser imaginären Linie an Portugal fallen. So kommt es, dass später der Ostteil Südamerikas (also Brasilien) von Lissabon beherrscht wird.
Bei ihrem Vormarsch durch die Neue Welt unterwerfen die Spanier zunächst die Antillen. Als dort durch eingeschleppte Krankheiten und die Folgen der Zwangsarbeit die meisten einheimischen Arbeitskräfte sterben und die Goldquellen mancherorts erschöpft sind, setzt 1519 die gezielte Eroberung des Festlands ein.
Der Abenteurer Hernando Cortés nutzt in jenem Jahr Spannungen unter den indianischen Völkern in Mexiko aus und kann deshalb mit zahlenmäßig weit unterlegenen Truppen bis zur Hauptstadt des Aztekenreiches, Tenochtitlán, gelangen. Mithilfe Zehntausender mit ihm verbündeter indianischer Krieger erobert er die Stadt und das Aztekenreich. Im April 1532 landet Francisco Pizarro mit etwa 180 Mann an der peruanischen Küste, nimmt wenige Monate später den Inkaherrscher Atahualpa gefangen und erobert im folgenden Jahr die Hauptstadt Cuzco. Nachdem die Konquistadoren anfangs nahezu unbeschränkt in Amerika herrschen können, entsendet die Krone schon bald loyale Beamte und bringt die eroberten Gebiete so unter ihre Kontrolle.
1556–1598: Philipp II.
Der Traum Karls V. von einem universalen, katholischen Kaisertum scheitert. Unter anderem muss er im Augsburger Religionsfrieden von 1555 die deutschen Protestanten anerkennen; zudem bleiben die Kriege gegen die Osmanen und Franzosen überwiegend erfolglos. Enttäuscht und ermüdet dankt der Kaiser ab und übergibt die Niederlande, Spanien, die italienischen Besitzungen und die überseeischen Kolonien zwischen 1554 und 1556 nach und nach an seinen Sohn Philipp. Karls Bruder Ferdinand folgt ihm als Herrscher im Heiligen Römischen Reich.
Philipp II. erbt von seinem Vater auch dessen vielfältige Konflikte. Recht schnell entscheidet er die schon lange währende Auseinandersetzung mit Frankreich militärisch vorläufig zu seinen Gunsten. Weitere Konflikte hat der König mit den Osmanen im Mittelmeer auszufechten, etwa in der – siegreichen – Seeschlacht von Lepanto.
Der Versuch des Monarchen, die in der Reformation zerfallene religiöse Einheit in den ererbten Ländern wiederherzustellen, provoziert in den wohlhabenden Niederlanden einen Aufstand der protestantischen Bevölkerung.
Daraufhin schickt Philipp II. seinen erfolgreichsten Feldherrn, den Herzog von Alba, gegen die Rebellen. Alba soll die Erhebung mit brutaler Härte niederschlagen, was die Situation freilich nur verschlimmert. Die Konfrontation in den Niederlanden prägt das Bild Madrids im Ausland nun nachhaltig, denn Propaganda wird immer mehr zum Mittel der Auseinandersetzung – und die Protestanten zeichnen Spanien in düsteren Farben als Hort religiöser Intoleranz.
Philipp II. ist ein tief religiöser Mensch. Der monumentale Palast El Escorial, den er nahe Madrid errichten lässt, ist Kloster und Residenz zugleich. Und auch die Selbstdisziplin, mit der der König sein Weltreich regiert, hat etwas Mönchisches. Um seinen vielen Aufgaben gerecht zu werden, baut er konsequent die Verwaltung aus, reformiert Justizwesen und Steuersystem. Der Monarch schafft so eine Herrschaftsstruktur, die es erlaubt, seinen Willen noch in die entlegensten Reichsteile zu tragen. 1580 fügt Philipp II. diesem Reich Portugal hinzu, auf dessen Thron er Ansprüche anmeldet und schließlich militärisch durchsetzt.
Spaniens Krone ist auf dem Höhepunkt ihrer Macht, denn zu ihren Besitzungen gehören jetzt auch die portugiesischen Kolonien in Südamerika, Afrika und Asien (etwa Teile Indiens und des heutigen Indonesien). Auf der Iberischen Halbinsel entwickeln sich Lissabon im Asien- und Sevilla im Amerikahandel zu Metropolen, in denen sich Kaufleute aus ganz Europa niederlassen. Farbstoffe, Gewürze, Zucker und andere Kolonialwaren verbreiten sich so in der Alten Welt.
England jedoch setzt mit seinen Kaperfahrten dem spanischen Kolonialhandel zu und unterstützt den Aufstand der Niederlande. 1588 entsendet Philipp II. deshalb eine Flotte von rund 130 Kriegsschiffen mit Invasionstruppen gegen Elisabeth I. von England. Nach mehreren Gefechten im Ärmelkanal geraten die Spanier im Nordatlantik vor Irland in einen Sturm, in dem große Teile der Armada untergehen. Damit ist der Plan einer spanischen Invasion gescheitert. Den Preis für die kostspielige Politik Philipps II. zahlt in zunehmendem Maße die kastilische Wirtschaft. Die sechs Millionen Einwohner Kastiliens – neben der Landwirtschaft traditionell tätig im Wollhandel, in der Seidenherstellung und in der Eisenverarbeitung – können die Abgaben kaum noch aufbringen. Der König ist bei seinen Bankiers ständig verschuldet. Dreimal erklärt er den Staatsbankrott, um seine Gläubiger so zu Zahlungsaufschüben und Zinssenkungen zu zwingen.
Auch das amerikanische Silber kann die Ausgaben nicht decken (obwohl bis 1660 insgesamt 17 000 Tonnen im Wert von 500 Millionen Dukaten nach Sevilla verschifft werden). Zudem lösen die Silberlieferungen in Spanien eine hohe Inflation aus.
zurück zur Hauptseite
1598–1788: Niedergang einer Großmacht
Wirtschaftlich ist Spanien erschöpft, auch politisch hat es mit dem Tod Philipps II. 1598 seinen Höhepunkt überschritten. Doch zugleich beginnt nun die Hochphase des „Goldenen Zeitalters“ der spanischen Kultur (das insgesamt von 1520 bis 1650 andauert).
Maler wie Diego Velázquez, El Greco, Francisco de Zurbarán und Bartolomé Esteban Murillo schaffen Kunstwerke von Weltgeltung. Miguel de Cervantes schreibt den Roman „Don Quijote“, der innerhalb weniger Jahre in ganz Europa verbreitet wird. Die Dichter Lope de Vega, Tirso de Molina und Calderón de la Barca schaffen neue Formen des Theaters wie etwa die comedia nueva, die auf die bis dahin übliche strikte Trennung von komischen und tragischen Elementen verzichtet.
Doch noch während Velázquez die Pracht der spanischen Krone verherrlicht, verfällt deren Macht.
1621 flammt der spanisch-niederländische Konflikt erneut auf. Die nördlichen Provinzen können nicht gehalten werden: Im Frieden von Münster muss Spanien 1648 deren Unabhängigkeit endgültig anerkennen, behält aber den katholischen Süden (der ungefähr dem Gebiet des heutigen Belgien entspricht).
Die Auseinandersetzungen mit Frankreich gehen indes weiter. Erst 1659 schließen Philipp IV. und Ludwig XIV. nach 24 Jahren Krieg den Pyrenäenfrieden. Neben territorialen Zugeständnissen Spaniens wird darin die Ehe des französischen Monarchen mit einer spanischen Prinzessin vereinbart – mit dieser Eheschließung legitimiert Ludwig XIV. 40 Jahre später die Ansprüche seiner Dynastie auf den spanischen Thron. In den folgenden Jahrzehnten muss Spanien weitere Gebiete, darunter die Freigrafschaft Burgund und den westlichen Teil Hispaniolas (das heutige Haiti), an Frankreich abtreten.
Karl II., der 1665 als Dreijähriger König wird, ist der letzte Habsburger auf dem spanischen Thron. Für den Minderjährigen führt zunächst seine Mutter die Regentschaft. Diese schwache Regierung kann die Wirtschaftskrise nicht meistern; der Binnenhandel geht zurück, Missernten verschlimmern die Lage weiter.
Der kinderlose Karl II. überträgt 1700 per Testament sein Erbe an einen Enkel Ludwigs XIV. (der ja 1660 die spanische Infantin geheiratet hat). Dieser Thronanwärter aus dem Haus der Bourbonen, Philipp von Anjou, muss jedoch gegen die österreichischen Habsburger kämpfen, die den spanischen Thron für Erzherzog Karl reklamieren. Dieser Konflikt führt zum Spanischen Erbfolgekrieg. Kastilien steht zu Philipp von Anjou, Aragón dagegen zu Karl. Der Erzherzog kann zunächst mit britischer und niederländischer Unterstützung militärische Erfolge erringen. Doch innenpolitische Machtverschiebungen in Großbritannien führen dazu, dass London aus dem Krieg ausscheidet.
Ohne diese Unterstützung müssen die Habsburger nun Philipp von Anjou als König von Spanien anerkennen: als Philipp V. Die Friedensregelungen bedeuten jedoch für Spanien – neben dem Machtwechsel von den Habsburgern zu den Bourbonen – gewaltige territoriale Verluste (etwa Süditalien).
Innenpolitisch ist die Zeit der Bourbonenherrschaft im 18. Jahrhundert eine Epoche der Reformen in nahezu allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Aufklärer, die häufig in höchste Staatsämter gelangen, erneuern Wirtschaft, Finanzwesen, Verwaltung, Justiz, Kirche, Infrastruktur und Militär.
1788–1898: Das Ende des Weltreichs
Der Reformprozess verlangsamt sich ab 1788 mit dem Amtsantritt Karls IV. (eines Enkels Philipps V.), vor allem aus Furcht vor dem Einfluss der Französischen Revolution auf die spanische Monarchie. Die Inquisition befasst sich nun in erster Linie mit der Zensur politischer Schriften.
Spanien führt anfangs Krieg gegen das revolutionäre Frankreich, wechselt dann aber die Fronten, um gemeinsam mit Paris ab 1796 gegen Großbritannien zu kämpfen. Beides endet mit Niederlagen. Schließlich bemüht sich die spanische Regierung um die Gunst Napoleon Bonapartes und verpflichtet sich 1807, ihn bei einem Angriff auf Portugal zu unterstützen. Dafür wird den Franzosen ein Durchmarschrecht für Truppen zugestanden. Nach seinem Sieg über Portugal aber besetzt Napoleon Spanien und erzwingt die Abdankung des Königs; stattdessen krönt er seinen Bruder Joseph. Doch gegen den bricht bei seinem Amtsantritt 1808 ein Volksaufstand aus. Angesichts der französischen Übermacht entwickeln die Spanier neue Formen der Kriegführung, es entsteht der Guerillakampf (von span. guerilla, „kleiner Krieg“). Zudem entsendet Großbritannien Truppen zur Unterstützung des Aufstandes, mit deren Hilfe die Franzosen bis 1814 vertrieben werden. Der Bourbone Ferdinand VII. kehrt auf den Thron zurück.
Die Umwälzungen in Spanien haben auch in Lateinamerika Folgen. Schon lange hat die Unzufriedenheit in den Kolonien zugenommen, ist die Hoheit des spanischen Mutterlandes von den Eliten dort immer stärker infrage gestellt worden. Innerhalb der Führungsschichten in den Kolonien stehen zwei Gruppierungen gegeneinander: die von der Iberischen Halbinsel ausgewanderten Europaspanier und die in Amerika geborenen Nachkommen ehemaliger spanischer Einwanderer, die „Kreolen“, die sich gegen die Bevormundung durch die europaspanische Elite wehren. Die Kreolen nutzen die Schwäche des besetzten Mutterlandes, um eine weitgehende Autonomie zu fordern. In Venezuela etwa unternehmen sie zweimal den Versuch, eine Republik zu gründen (1811/12 und 1813/14). Mit der Rückkehr des Königs auf den Thron in Spanien wird die Unabhängigkeitsbewegung zunächst fast überall niedergeschlagen. Der Anführer zur Zeit der zweiten venezolanischen Republik, der charismatische Kreole Simón Bolívar, muss das Land verlassen.
Ende 1816 kehrt er zurück und kann bald darauf mehrere antispanische Heere unter seinem Oberbefehl vereinen. Bolívars Truppen erringen bedeutende Siege und dringen in das Kerngebiet des Vizekönigreichs Neu-Granada ein. Nach einer entscheidenden Niederlage in der Nähe von Bogotá, der Hauptstadt Neu-Granadas, verlässt der Vizekönig das Land. 1819 entsteht die Republik Kolumbien (später Großkolumbien genannt). Sie umfasst die Gebiete Venezuela, Neu-Granada und Quito; 1821 wird Simón Bolívar ihr erster Präsident. Sie existiert bis 1830, zerfällt dann in drei souveräne Staaten.
In Mexiko verbünden sich Kreolen mit Royalisten und erklären 1821 die Unabhängigkeit des Landes. Im folgenden Jahr proklamieren sie den Kreolen Agustín Iturbide zum Kaiser. Doch er kann sich nur wenige Monate im Amt halten; 1824 wird Mexiko zur Republik. Bis 1825 erkämpft fast ganz Hispanoamerika die Unabhängigkeit.
Von dem gewaltigen spanischen Kolonialreich bleiben nur einige Inseln wie Kuba und die Philippinen übrig. Und auch die gehen verloren, 1898, nach der Niederlage im Krieg gegen die USA.
Damit ist Spanien endgültig keine Weltmacht mehr. Der König in Madrid gebietet nicht mehr – wie einst Karl V. – über ein Reich, von dem es hieß, dass in ihm nie die Sonne untergehe.