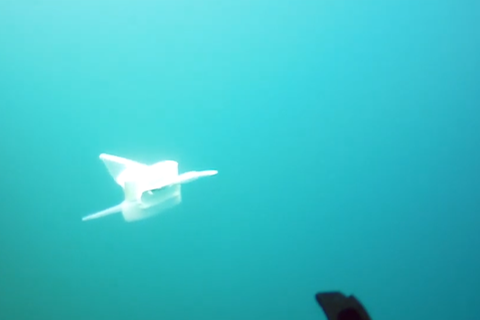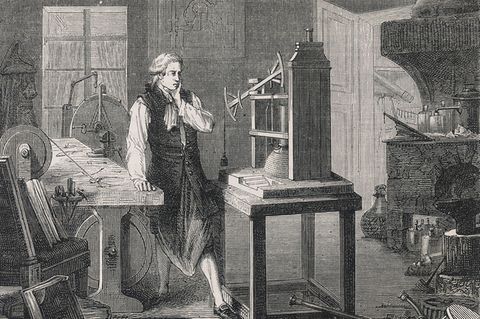1968 ist das Jahr der Revolte. Weltweit gehen junge Menschen auf die Straße, um für eine bessere Gesellschaft zu kämpfen. Doch die mit Abstand folgenreichste Revolution dieser Monate erregt kaum Aufmerksamkeit. Sie beginnt am 9. Dezember in einem Auditorium in San Francisco.
Douglas Engelbart (1925–2013) heißt der Anführer dieser Revolution. Er spricht nicht zu einer aufgepeitschten Menge, sondern vor einem Fachpublikum; sitzt an einem Schreibtisch auf einer Bühne, vor sich eine Tastatur, mit einem Computer verbunden.
Computermaus ist Engelbarts wichtigstes Werkzeug
Um die Wörter auf dem Bildschirm zu verschieben, bewegt er mit der Hand eine kleine Kiste über den Tisch – eine frühe Computermaus.
Sie ist das wichtigste Werkzeug Engelbarts, der ein radikales Ziel verfolgt: Der Ingenieur will dem Militär, den US-Forschungsinstitutionen und der Industrie die Macht über die Computer entreißen und die Rechner allen Bürgern zur Verfügung stellen. Es ist sein Kreuzzug für eine bessere Welt.
Vor 50 Jahren, am 9. Dezember 1968, hält Douglas Engelbart am Stanford Research Institute einen sensationellen Vortrag, der als "The Mother of All Demos" in die Geschichte eingeht. Das Video zeigt einen Zusammenschnitt.
Douglas Engelbart geht zum Stanford Research Institute
Jahrelang hat der Amerikaner an der perfekten Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine getüftelt, an einem Gerät, mit dem auch Laien arbeiten können. Er promoviert zum Thema und erhält Ende der 1950er Jahre eine Stelle am Stanford Research Institute, einem unabhängigen Forschungszentrum an der Bucht von San Francisco, das eng mit Industrie und Militär zusammenarbeitet.
Fast alle Rechner dort sind auf dem damaligen Stand der Technik – also groß, unpraktisch und unfassbar teuer. Mitte der 1960er Jahre kostet ein Hochleistungsrechner so viel wie 250 Kleinwagen. Schon drei Jahrzehnte zuvor hat Konrad Zuse in Berlin einen vollmechanischen Rechner konstruiert.
Im Z1 schieben Tausende bewegliche Bleche kleine Metallstifte zwischen je zwei Positionen hin und her. 1941 führt Zuse den Z3 vor, den ersten funktionsfähigen Rechner mit Programmsteuerung. Ein Gerät, das alle Informationen als Abfolge von zwei Zuständen ausdrückt und verarbeitet: 1 und 0, Strom an und Strom aus.
Bis heute beruhen sämtliche Rechenvorgänge in Computern auf diesem Prinzip.
In Deutschland bleibt Zuse ein Außenseiter – anders als seine Kollegen in den USA, die unabhängig von Zuse und mit enormer finanzieller Unterstützung immer leistungsfähigere Computer bauen. Doch noch zu Engelbarts Zeiten in Stanford sind diese Maschinen nicht viel mehr als leistungsfähige Rechenschieber: extrem komplizierte, teure Kalkulatoren, von Nutzen etwa für die Streitkräfte, um Flugbahnen von Interkontinentalraketen zu berechnen und Verschlüsselungen zu knacken.
Engelbart kommt zu einer simplen, aber genialen Lösung
Aber sie sind nicht geeignet für Privatpersonen und Kleinunternehmer. Um den Computer zu demokratisieren, muss er auch für Laien verständlich sein. Engelbart arbeitet daher an Geräten, die jeder handhaben kann. Der Nutzer soll ganz einfach von Textstelle zu Textstelle, von Seite zu Seite springen können.
Die Suche nach der perfekten Eingabetechnik ist schwierig. Lochkarten hält Engelbart für ungeeignet. Der Ingenieur will die Bewegungen der Hand direkt in Maschinensprache übersetzen: Der Anwender soll seinem Computer mit einem Fingerzeig Befehle geben können.
Zu diesem Zweck testet Engelbart unter anderem einen Lichtgriffel, eine Art Stift mit einem Sensor in der Spitze. Doch dessen Verwendung, so die Erkenntnis, ist auf die Dauer zu anstrengend für den Arm des Nutzers. Auch ein Eingabegerät für das Knie unter der Schreibtischplatte schließt Engelbart aus.
Nach zahlreichen Tests kommen der Ingenieur und sein Team gegen Mitte der 1960er Jahre zu einer simplen, aber genialen Lösung: einer mit zwei Rädern und einer Taste versehenen kleinen Kiste, die sich über den Tisch schieben lässt.
Am 9. Dezember 1968 ist alles bereit für die digitale Revolution
Einer aus dem Erfinderteam gibt dem „X-Y-Positionsindikator für ein Bildschirmsystem“ einen Spitznamen: Maus. Wochenlang planen Engelbart und sein Team nun den Auftritt auf der Konferenz in San Francisco. Am 9. Dezember 1968 ist endlich alles bereit für die digitale Revolution.
Schon der Vortrag an sich ist ein technisches Meisterstück: Engelbart wird von mehreren Kameras gefilmt, auf der Leinwand wird mal der Bildschirminhalt gezeigt, mal erscheinen Engelbarts Hände, mal sein Gesicht – oft zwei Motive gleichzeitig im Splitscreen oder überblendet, alles live.
Vor allem aber: Zum ersten Mal in der Geschichte sehen die Zuschauer bei dieser Präsentation auf einem Monitor eine Vorform moderner grafischer Benutzeroberflächen. Schließlich schaltet Engelbart seine Kollegen aus Stanford mit auf den Bildschirm und arbeitet gleichzeitig mit ihnen an einem Dokument – und zeigt so den verblüfften Zuschauern, wie er sich vernetztes Arbeiten vorstellt.
Die größte Umwälzung von allen aber versteckt Engelbart in einer Randbemerkung – vielleicht, weil selbst der Visionär ihre Bedeutung nicht erfassen kann: Der Rechner seines Instituts soll Teil des „Arpanet“ werden, eines umfassenden, vom Verteidigungsministerium initiierten Computernetzes.
Die Idee eines Rechnernetzes passt zu Engelbarts Denken. Er will eine Community der Computernutzer schaffen, eine Gemeinschaft, die ihr Wissen austauscht und gemeinsam mehrt. Die Präsentation wird ein Triumph. „Die Leute waren verzaubert“, erinnert sich ein Teilnehmer.
Engelbarts wahre Erben: Steve Jobs und Steve Wozniak
Die Fachpresse schreibt begeistert über die „Mensch-Computer-Partnerschaft“ und über die kommende „Lichtgeschwindigkeitsgesellschaft“. Doch die Euphorie verpufft. Der geniale Erfinder ist ein miserabler Verkäufer seiner Idee.
Selbst enge Mitarbeiter kann er nicht halten. Anfang der 1970er Jahre wandern sie zum Technologiekonzern Xerox ab. Dort entwickeln sie Engelbarts Ideen weiter. 1973 stellt Xerox einen Computer vor, der in vielen Punkten bereits einem modernen PC ähnelt.
Etwa 2000 Exemplare werden von dem Rechner gebaut, doch Xerox glaubt nicht an seine Popularität und bringt ihn nicht auf den Markt. Engelbarts Ideen aber sind in der Welt. Seine wahren Erben werden zwei junge Bastler, die 1976 in einer Garage eine eigene Computerfirma gründen: Steve Jobs und Steve Wozniak, die mit ihren Apple-Rechnern die Branche revolutionieren.
1980 schließen sie mit Engelbart einen Lizenzvertrag über das Patent für die Maus ab, der ihm 40 000 Dollar einbringt. Vier Jahre später stellt Apple den „Macintosh“ vor, der auf Ideen Engelbarts basiert: mit Maus und grafischer Benutzeroberfläche. Und dank neuer, kleiner und billiger Halbleiter-Chips taugen Computer mittlerweile auch zur Massenware.
Erst in den 1990er Jahren entdeckt die Branche jenen Mann wieder, dem sie ihre Existenz verdankt. Das Massachusetts Institute of Technology verleiht ihm einen mit 500 000 Dollar dotierten Erfinderpreis. Als der Pionier, dessen Vision eines Computers für jedermann längst Wirklichkeit geworden ist, im Jahr 2013 stirbt, huldigt ihm Apple-Gründer Wozniak mit den Worten: „Für mich ist er ein Gott. Alles geht auf seine Gedanken zurück.“