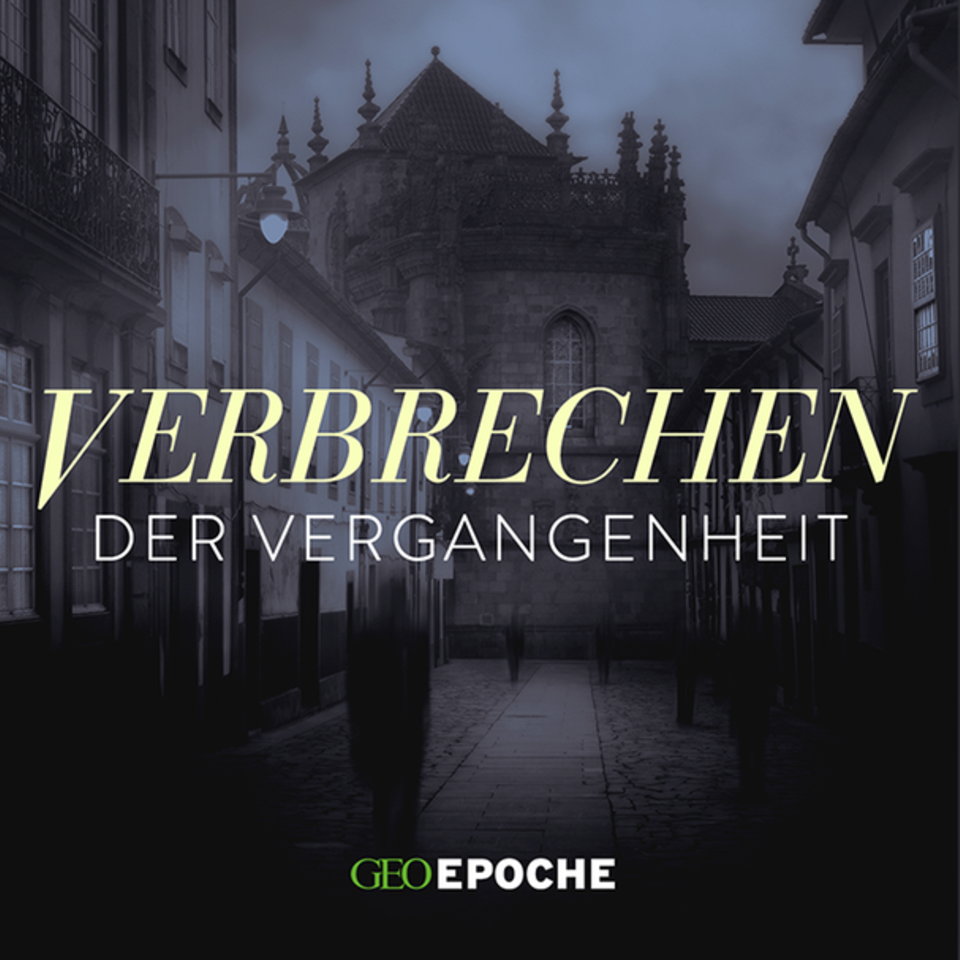Ein Freitag im Herbst, er tritt aus der Kirchentür und geht zum Parkplatz, als plötzlich ein Fremder seinen Namen ruft. Bist du Dritan Prroj? Ja, antwortet der Pastor, was kann ich für dich tun? Und der Mann, fast noch ein Junge, zieht die Pistole und schießt. Eine Kugel trifft Prroj ins Bein. Eine verwundet einen Mann, der nur zufällig auf der Straße steht in diesem Augenblick, in dem Dritan Prroj sterben soll für einen Mord, den ein anderer begangen hat.
Er flieht, der Junge folgt, sie stolpern um eine Straßenecke, vor einem Laden tötet der Fremde Dritan Prroj. Der Pastor bricht zusammen, acht Kugeln im Körper.
Fünf Jahre zuvor hat sein Onkel hier in der Stadt Shkodra einen Mann erschossen. An diesem Tag nimmt die Familie des Toten ihre Rache. Blut verlangt Blut.
Denn hier im Norden Albaniens folgt die Rache uralten Regeln, dem Recht der Berge. Mord gebiert Mord. Und für die Tat eines Einzelnen muss eine ganze Familie büßen. Muss der Täter sterben oder ein anderer Mann seines Clans, ein Bruder, ein Sohn.
Im Namen dieses Rechts stirbt an jenem Tag im Oktober 2010 Dritan Prroj, 34 Jahre alt, Pastor der evangelischen Kirche Fjala e Krishtit, Wort Christi, als er seine Kinder aus der Schule abholen will.
Elona Prroj wartet an diesem Tag daheim auf ihren Mann. Versucht, ihn am Telefon zu erreichen, während die Zeit dahingeht und immer mehr Menschen aus der Gemeinde anrufen und fragen, wo der Pastor ist, bis das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, zur Gewissheit wächst und sie nach draußen treibt.
Zwei Stunden läuft sie durch die Straßen. Schließlich begleitet ihr Schwager sie zum Krankenhaus, und dort sind Polizisten, die sagen, sie müsse ins Leichenschauhaus gehen. Da begreift sie, dass es zu Ende ist mit ihm. Dass es vorbei ist, das Warten, die Hoffnung, die Angst. Dass die Blutrache ihr Opfer gefordert hat, einmal mehr.
Diese archaische Tradition ist festgeschrieben im Gesetz der Berge. Gjakmarrje, Blutnehmen, heißt sie im kanun, dem Gewohnheitsrecht, das seit Menschengedenken das Leben im albanischen Hochland bestimmt. Über Jahrhunderte stand in den Bergen der Kanun über der Ordnung der Herrschenden, dem Recht der Sultane und später dem des Fürsten, des Königs. Erst dem kommunistischen Regime ab 1944 gelang es, die Autorität des Kanun zu brechen. Für viereinhalb Jahrzehnte schien die Blutrache erloschen.
Aber nach dem Sturz der Diktatur im Februar 1991, als die Demokratie jung war und der neue Staat schwach, kehrte die Rache zurück mit aller Macht. Was die Kommunisten unterdrückt hatten, wurde wieder Alltag.
Nach dem Gesetz der Berge verlangt nicht allein der Tod eines Menschen die Ermordung eines anderen. Es ist die Ehre eines Mannes, die, einmal beschmutzt, nur mit Blut reingewaschen werden kann. Die Ehre, die mehr wert ist als das Leben selbst.
Jede Tötung aber bedeutet eine neue Ehrverletzung. So werden Fehden geboren, ein Kreislauf, der Generationen überdauern kann. Mit jedem Mord wechselt die Pflicht zur Rache von einer Familie zur anderen. Und immer werden auch Väter, Brüder, Söhne, Neffen zu Gejagten.
Die Welt, die ein solches Recht hervorgebracht hat, existierte lange in sich verschlossen, abgeschieden vom Rest des Landes.
In den 1960er Jahren ist die Blutrache so gut wie ausgelöscht
Als Albanien im 15. Jahrhundert an das Osmanische Reich fällt, flüchten im Norden viele Menschen in die Berge. In der kargen Gegend, wo Zusammenhalt überlebensnotwendig ist, wächst eine Stammesgesellschaft heran. Zu einer Sippe gehören alle Blutsverwandten, die ihre Abstammung auf einen gemeinsamen männlichen Vorfahren zurückführen.
Die entlegenen Bergdörfer entziehen sich der Macht der osmanischen Sultane, regieren sich selbst. Der Kodex, nach dem die Menschen hier leben, reicht zurück in eine Zeit weit vor der osmanischen Eroberung. Manche seiner Normen bestehen wahrscheinlich seit der Antike. Eine Richtschnur, die Jahrtausende überspannt.
Mehrere dieser althergebrachten Rechtsvorstellungen stehen im osmanisch regierten Albanien nebeneinander, ähnlich in ihren Vorschriften, jede mit Geltung in einer anderen Region. Lange nur mündlich überliefert, werden die verschiedenen Varianten des Kanun erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts allmählich niedergeschrieben. Die bekannteste trägt ab 1898 ein Franziskanerpater zusammen.
Ihre 1263 Abschnitte umschreiben das ganze Leben, von der Wiege bis zum Grab. Hochzeiten und Todesfälle, Jagd und Fischfang, die Arbeit von Schmieden. Die Regeln des Kanun sind den Menschen im nördlichen Hochland heiliger als die Lehren von Islam und Katholizismus.
Die wichtigsten Werte, die der Kanun kennt, sind Ehre und Gastfreundschaft. Um den Gast zu verpflegen und zu beherbergen, muss jeder Hausherr aufwenden, was er hat. Das Haus des Albaners gehört Gott und dem Gast.
Die Rache aber gehört nicht Gott. Sie ist den Menschen überlassen: Der starke Mann holt sich selbst die Buße.
Die Regeln der Blutrache sind nur ein kleiner Teil des Kanun. Aber sie sind genauer beschrieben als jede andere Pflicht. Für besonders schwere Verbrechen, etwa die Tötung eines Priesters, eines Gastes, des eigenen Vaters, eines Verwandten aus Erbschaftsgründen, kennt der Kanun die Todesstrafe, vollstreckt von der Gemeinschaft.
Seine Ehre muss ein Mann indes allein verteidigen. Sie wird ihm geraubt, wenn man ihn schlägt, bespuckt, bedroht, wenn man ihn vor anderen Männern der Lüge bezichtigt, wenn ihm ein anderer ein Darlehen nicht zurückzahlt, in sein Haus oder in seine Scheune einbricht, seine Frau verführt, vergewaltigt oder entführt oder ihn als Gastgeber beleidigt. Wer seine Ehre wiederhaben möchte, muss töten.

Neben dem Täter kann auch jeder seiner männlichen Verwandten Ziel der Rache werden, jeder erwachsene Mann, der sein Blut und seinen Namen teilt. Ein Junge gilt als erwachsen, sobald er ein Gewehr tragen kann.
Frauen nimmt der Kanun von der Rache aus. Eine Frau erbt nicht und besitzt nichts, ist nicht mehr als eine Hülle, in der Ware transportiert wird, zum Gebären bestimmt.
Den Männern, die Blut schulden, bleibt, so will es der Kanun, nur ein einziger sicherer Ort: das eigene Haus. Wer es verlässt, der kann überall auf den Tod treffen.
Nur auf zwei Wegen endet eine Blutfehde. Wenn Vermittler eine Versöhnung der beiden Familien aushandeln. Das Ritual ist festgeschrieben: Zwei Männer, deren kleine Finger verbunden und mit einer Nadel durchstochen werden. Zwei Tropfen Blut, die in Gläser fallen. Sie trinken mit überkreuzten Händen, jeder das Blut des anderen. Ein Kreuz am Haus markiert das Ende der Fehde.
Die andere Möglichkeit ist, wenn in einer Familie keine Männer mehr übrig sind.
Die Blutfehden bestehen fort, als die osmanische Herrschaft zu Ende geht, als das unabhängige Albanien Fürstentum wird, kurz Republik und schließlich Monarchie, als im April 1939 italienische Truppen das Königreich besetzen und im September 1943 die deutsche Wehrmacht, als Ende November 1944 die Kommunisten die Macht in Tirana übernehmen und in den frühen Jahren der Sozialistischen Volksrepublik Albanien.
Die 1941 gegründete kommunistische Partei kämpft während des Zweiten Weltkriegs gegen die Anhänger der nationalistischen Befreiungsbewegung. Die Kommunisten setzen sich schließlich durch in diesem inneralbanischen Krieg. Ihr Anführer Enver Hoxha wird Albaniens Diktator.
Unter Enver Hoxha orientieren sich die Kommunisten an den brutalen Regimen Stalins und Mao Zedongs. Sie verstaatlichen Industrieunternehmen, enteignen Landbesitzer, unterdrücken die Opposition, errichten eine Einparteienherrschaft. Niemand ist der Kontrolle des Staates entzogen.
Einen sozialistischen Menschen wollen Hoxhas Kommunisten erschaffen, und so verbannen sie den Kanun ins Archiv des Instituts für Volkskultur. Auf Blutrachemorde steht jetzt die Todesstrafe. Familien, die an einer Fehde beteiligt sind, werden voneinander getrennt und umgesiedelt in unterschiedliche Teile des Landes.
In den 1960er Jahren ist die Blutrache so gut wie ausgelöscht. Bald darauf verbietet Hoxha alle Religionen. Immer rigoroser wird das Regime, immer mächtiger die Geheimpolizei. Zehntausende sind in Lagern interniert.
Als Enver Hoxha 1985 stirbt, ist Albanien das drittärmste Land der Erde. Die Bevölkerung hungert, Essensrationen sind knapp, Menschen dürfen fast nichts besitzen außer ihren Häusern.
Fünf Jahre nach dem Tod des Diktators bricht sein Regime zusammen. Am 20. Februar 1991 versammeln sich mehr als 100 000 Einwohner der Hauptstadt Tirana, um eine Bronzestatue Hoxhas im Zentrum zu stürzen.
Häufig ist die Blutrache nur noch ein Vorwand, um Selbstjustiz zu rechtfertigen
Elona Prroj, die Tochter eines Schmieds aus einer Stadt im Süden, ist damals zehn Jahre alt. Wenn sie heute zurückdenkt an diese Zeit, dann erinnert sie sich vor allem an ein Gefühl: Hoffnung. Sie erinnert sich an die vielen Missionare, die nach Albanien kommen, an Stadien voller Menschen, die sich von Gott erzählen lassen wollen.
Ihre ältere Schwester besucht eine Bibelschule in Tirana, und sie bekehrt auch Eltern und Geschwister. Da war ein Hunger, sagt Elona, ein Hunger in den Herzen.
Der Zusammenbruch des Regimes hat ein Vakuum hinterlassen. Viele besinnen sich auf das, was war, bevor die Kommunisten kamen. Alte Werte gelten wieder. Alte Konflikte brechen wieder auf. Alle Spannungen, alle Gegensätze in der Bevölkerung haben die Kommunisten jahrzehntelang nur unterdrückt, Einheit erzwungen.
Albanien hat keine demokratische Tradition, die nun wiederaufleben könnte, keine Erinnerung an eine politische Kultur, eine Zivilgesellschaft, auf die sich nun bauen ließe. Seine Bürger kennen keine politische Beteiligung, kein Parteiensystem. Dieses Erbe lastet schwer auf dem Land.
Schon im ersten Jahr der neuen Zeit berichten die Zeitungen von Männern, die auf offener Straße umgebracht werden, um eine jahrzehntealte Blutschuld zu begleichen, eine Tötung zu rächen, die ihr Vater oder Großvater begangen hat, vor dem Weltkrieg, ein halbes Jahrhundert zuvor.
Viele der neuen Blutfehden gründen in dem Wunsch nach Rache an ehemaligen Funktionären des Regimes, an Polizisten und Mitarbeitern des Geheimdienstes, für Übergriffe und erlittenes Unrecht. Entstehen im Streit um Grundstücksgrenzen und Bewässerungskanäle, um Land, das unter kommunistischer Herrschaft enteignet und umverteilt worden ist und nun wieder privatisiert wird.
Die Blutrache folgt jetzt oft nicht mehr den alten Regeln. Häufig ist sie nur noch ein Vorwand, um Selbstjustiz zu rechtfertigen. Ein Unfall, eine fahrlässige Tötung reichen aus für einen Mord.
Blutfehden vermischen sich mit organisierter Kriminalität, mit Streitigkeiten zwischen Familienclans, die mit Drogen handeln und mit Menschen. Geschäfte, in die auch viele Politiker und Beamte verwickelt sein sollen. Auch Frauen können jetzt zu Opfern werden, und manchmal zu Täterinnen.
Der neue Staat ist schwach, arm und korrupt. Nicht in der Lage, seine Ordnung durchzusetzen, und manchmal nicht willens. Viele seiner Beamten sind käuflich, die Mehrheit seiner Bürger lehnt sein Recht, seine Regierenden ab. Nach einer Übergangszeit, geprägt von Unruhen, Rechtlosigkeit, Massenflucht, gewinnt 1992 die antikommunistische Opposition die Wahlen. Doch als fünf Jahre später die Wirtschaft zusammenbricht, die Regierung stürzt und die Vereinten Nationen Friedenstruppen schicken, gelingt bei Wahlen den Sozialisten der Sieg. In der Folge prägt der Kampf dieser beiden Blöcke den Staat.
Elona Prrojs Leben entwickelt sich in dieser Zeit wie unbeirrt von den Krisen im Land, so früh scheint für sie alles festzustehen. Mit 14 zieht sie zu ihrer Schwester in den Norden, nach Shkodra, wo ihr Schwager Pastor einer evangelischen Kirche ist. Sie ist 16, als sie sich verlobt, mit Dritan, fünf Jahre älter als sie, der beste Freund ihres Schwagers, in der Gemeinde die rechte Hand des Pastors. Sie heiraten, Dritan Prroj wird Pastor, und sie haben zwei Kinder.
120 Familien leben in Albanien in Blutrache, wahrscheinlich sind es viel mehr
Oft betteln Frauen in der Kirche um Essen. Elona ärgert sich dar über, wieso arbeiten die nicht hart? Sie fragt eine, und die sagt: Sie haben meinen Mann erschossen, als er kurz in den Hof gegangen ist, der Täter wartete hinter dem Gartentor.
Die Familien der Frauen, die um Essen betteln, leben in Blutrache. In ihren Häusern verstecken sich Ehemänner, Väter, Söhne hinter verschlossenen Türen und verdunkelten Fenstern vor dem Tod.
An einem Abend im September 2005 stehen zwei Männer aus der Nachbarschaft vor Elonas Tür. Geh nicht nach draußen, warnen sie Dritan: Dein Onkel hat einen Mann getötet. Was genau geschehen ist, bleibt verworren.
Nikollë Prroj, Besitzer eines Lokals, hat einen Mann erschossen. Nicht den Betrunkenen, der ihn beleidigt hat, sondern einen Polizisten in Zivil, der den Streit schlichten wollte. Notwehr, ein Unglück, ein Schuss, der den Falschen getroffen hat: Vielleicht war es so, wie seine Familie es erklärt, sich und anderen. Sicher ist, was nach dem Schuss kommt. Nikollë Prroj flieht aus seinem Lokal und taucht unter.
Von diesem Tag an verlassen 25 Männer seiner Familie das Haus nicht mehr, sperren sich selbst aus Angst ein. Zwei der 25 sind der Pastor Dritan Prroj und sein Sohn Gabriel, vier Jahre alt.
Der Kanun verbietet das Töten von Kindern. Aber als sie Gabriel nach einem Jahr im Versteck im Kindergarten anmeldet, warnt Elona die Betreiber, ihren Sohn nicht nach draußen zu lassen, wenn jemand nach ihm fragt.
Dritan kann die Rache ohnehin jederzeit treffen. Zwar nimmt der Kanun Priester ausdrücklich von der Blutrache aus – doch dies gilt nur für Katholiken, nicht für einen evangelischen Prediger.
Anfangs glaubt Elona noch, dass alles gut wird. Du weißt nicht, in was für einen Kreislauf deine Familie eingetreten ist, sagen die anderen. Wir sollten mit der anderen Familie reden, sagt Elona, sie sind doch Menschen, sie werden verstehen, dass wir gegen das Töten sind und dass es uns so leidtut, was geschehen ist. Du verstehst nicht, sagen die anderen.
Sie glaubt, dass alles gelöst werden kann. Wir werden eine Weile im Haus bleiben, dann schicken wir die Ältesten, um für uns um Vergebung zu bitten. Wir haben nichts getan, mach dir keine Sorgen, sagt sie zu ihrem Mann. Du verstehst nicht, sagt er.
Und es wird nicht wieder gut. Vier Jahre lang verlässt ihr Mann das Haus nur sehr selten, hält die Kirchentreffen daheim ab.
Das Leben: nur eine Reihe von überstandenen Tagen.

Immer wieder versuchen Elona und Dritan, Vermittler zur Familie des toten Polizisten zu schicken. Jedes Mal zahlen sie ihnen viel Geld für ihre Dienste, jedes Mal kommen die Beauftragten ohne Ergebnis zurück. Die Familie will nicht verhandeln.
Eines Tages sagt Dritan, er habe sich entschieden: Er werde fortan das Haus verlassen. Einfach brechen mit dem Tabu, das Unschuldigen wie ihm die Freiheit nimmt. Er will kein Gefangener mehr sein. Er will kämpfen. Ein Zeichen setzen gegen die Blutrache. Gott habe zu ihm gesprochen und ihm diesen Auftrag erteilt.
Für ein Jahr kehrt er zurück in die Welt vor der Tür des Hauses. Und Elona ist stets dabei. Sie hat gelesen, dass der Kanun es verbietet, einen Mann zu töten, wenn er von einer Frau begleitet wird.
Dann kommt dieser Freitag, an dem er seine Predigt für den Sonntag vorbereitet. Er will nur kurz in der Kirche vorbeischauen, die Kinder von der Schule abholen und gleich wieder nach Hause kommen. Komm nicht mit, sagt er. Sie ist nicht da an diesem Tag, und wenn Gott da ist, dann hilft er ihm nicht. Acht Kugeln.
Zweieinhalb Jahre später ändert die albanische Regierung das Strafgesetzbuch. Auf Blutrachemorde stehen jetzt mindestens 30 Jahre. Aber zu Verurteilungen kommt es nur selten. Viele Betroffene glauben nicht, dass der Staat ihnen Gerechtigkeit verschaffen kann. Hilfe erwarten sie sich nur von Geistlichen und von Gott.
Die Justiz ist noch immer korrupt und ineffizient. Allzu oft entscheiden Geld und Beziehungen darüber, ob ein Verfahren eingeleitet, ein Urteil gesprochen wird.
Und es gibt andere, denen alle Strafen, die der Staat verhängt, nicht reichen: Angehörige von Opfern, die als Zeugen für den Mörder aussagen, um dessen Freilassung zu erwirken und ihn dann selbst zu richten. Die einen Täter nach langer Haft am Tag seiner Entlassung aus dem Gefängnis töten.
Mindestens 120 Familien leben 2017 in Blutrache, wahrscheinlich sind es viel mehr – obwohl die Morde seltener geworden sind, weil die Bedeutung der Familie und des Clans allmählich abnimmt.
Eine Woche vor seinem Tod trifft Dritan Prroj seinen Bruder auf einen Kaffee und nimmt ihm ein Versprechen ab: Wenn sie mich töten, dann soll unsere Familie mein Blut vergeben. Der Bruder gibt ihm das Versprechen.
Elona erfährt davon erst nach seinem Tod, und sie denkt, er wusste es. Er wusste, was kommt.
Am dritten Tag nach der Beerdigung vergibt die Familie Prroj den Angehörigen des Täters. Ihre Familie wird den Kreislauf des Tötens unterbrechen.
Es ist leicht, dem Täter zu verzeihen, findet Elona. Als sein Onkel bei dem Streit in dem Lokal getötet wurde, war er 16 Jahre alt, ein Junge, dem die nächsten fünf Jahre alle um ihn herum die Rache einredeten. Er tut ihr leid.
Der Mensch aber, dem Elona lange nicht vergeben kann, ist die Mutter des Jungen. Wie kann sie ihn ermutigen, einer anderen Frau den Mann zu nehmen, Kindern den Vater? Hätte ich das mit meinem Sohn gemacht, sagt Elona, hätte ich in ein paar Jahren einen Mörder in meinem Haus gehabt.
Dritan ist tot, der Täter sitzt im Gefängnis. Der Onkel, der mit einem Schuss die Fehde ausgelöst hat, bleibt lange verschwunden und wird in Abwesenheit verurteilt. Als er acht Jahre nach der Tat wieder auftaucht, ist seine Strafe verjährt. Er lebt wieder in Shkodra, ein freier Mann. Die Vergebung, die ihre Familie gewährt hat, ist die einzige, die Elona je erlebt hat.
Und dann erzählt sie von Bekannten, Vater, Mutter, sechs Söhne, ein Neffe. 18 Jahre dauert die Blutfehde nun, in der sie sich befinden, sechs Menschen aus zwei Familien sind tot, einer von ihnen der Vater des Neffen. Als er getötet wurde, war der Junge noch nicht geboren. An seinem ersten Geburtstag erhängte sich die Mutter.
Der Junge wächst beim Onkel auf. Als Elona die Familie besucht, klagt die Tante, er wolle nicht zur Schule gehen. Warum nicht, fragt Elona, und er fragt zurück: Warum sollte ich? Wenn ich erwachsen bin, werde ich töten oder getötet werden. Er ist zehn Jahre alt.