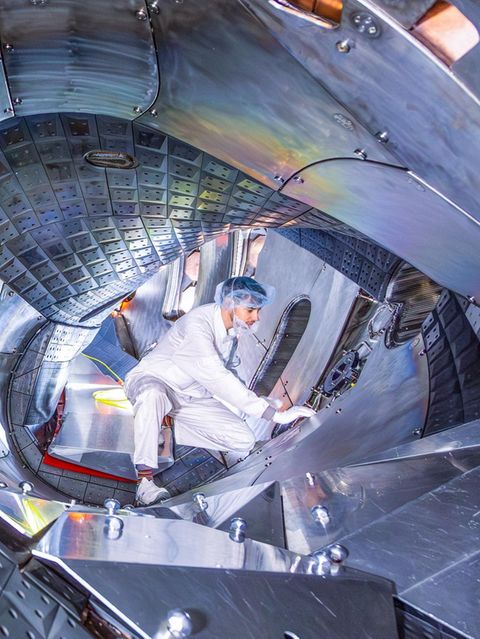"Ich geh dann mal rüber", sagt der Mann mit den Adiletten und erhebt sich von der Parkbank. "Vielleicht krieg' ich ja noch was zu essen." Es sieht nicht gut aus für ihn. Seine thailändische Frau kocht einfach zu gut, vor ihr hat sich eine kleine Schlange gebildet. Sie kniet auf einer Bastmatte auf dem Rasen, um sich herum Woks und Töpfe auf Gaskochern. Konzentriert bereitet sie pad thai zu, frittierte Reisnudeln: Knoblauch und Schalotten, jetzt die Nudeln dazu, Fischsauce, Tamarinde, Chilischoten, Sojasauce, dann das Ei, Shrimps. "Somchai, Serviette!" Ihr kleiner Sohn faltet ein Stück Küchenkrepp, sie lässt die Nudelmasse auf einen Pappteller gleiten. Erdnüsse und Sojasprossen, Limette, fertig, dazu ein kaltes Chang-Bier. Sechs Euro, bitte. Ich lasse mich mit dem dampfenden Teller ein paar Meter weiter ins Gras sinken, glücklich. Die Frau ist schon mit der nächsten Bestellung beschäftigt. Es ist Sonntagnachmittag im Thaipark, wie der Preußenpark mitten im bürgerlichen Wilmersdorf inzwischen genannt wird. Am Wochenende trifft sich hier die asiatische Gemeinde Berlins, vor allem Thais, aber auch Filipinos und Laoten. Es wird geschwatzt, gespielt, gekocht. Offiziell nur für den privaten Gebrauch, doch es hat sich herumgesprochen, dass man hier köstliche Hausfrauenkost zu Kantinenpreisen bekommt, fish cakes, frittierte Bananen, hausgemachte Currypasten, neonfarbene Süßspeisen aus Tapioka-Perlen. "Bisschen wie im Lumphini Park hier", sagt ein Freund, der Bangkok gut kennt. Ähnliche Sätze werde ich in allen möglichen Variationen noch öfter hören. Die Stimmung im "Kiki Blofeld" am Spreeufer: "wie eine Full Moon Party auf Koh Phangan vor 20 Jahren". Der Luisenstädtische Friedhof: "ein bisschen wie Père Lachaise". Die Simon-Dach- Straße in Friedrichshain: "wie Schwabing in den Siebzigern". Und überhaupt, alles zusammen: "wie Prag in den Neunzigern". Berlin besteht nicht wie viele andere Städte aus Dörfern, so scheint es, sondern aus Welten. Dieses Patchwork aus Erinnerungen an andere Orte und Epochen, das Las Vegas künstlich erschaffen hat, ist in Berlin gewachsen. Eine Weltwohngemeinschaft hat der Maler Daniel Richter die Stadt mal genannt, und das trifft es ziemlich gut: Das Zusammengewürfelte und das Improvisierte, die Kollisionen und die Kompromisse, das macht diese Stadt aus, die so gern Metropole wäre und doch noch nicht ganz trocken hinter den Ohren ist. Alles ist nach wie vor im Aufbruch und löst dieses merkwürdige Puckern aus bei fast jedem, der hierherkommt. Eine Ahnung, dass an diesem Ort was ginge: ein Neuanfang, eine zweite Jugend, ein anderes Leben. Berlin, die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten - das Gefühl packt einen auch mit 50 noch. Mit einer gewissen Backpacker- Mentalität kommt man gerade im Sommer am weitesten hier. Am besten, man mietet sich ein Rad, am allerbesten, man lässt den Reiseführer zu Hause. Eine Sommerreise entbindet einen ja ohnehin von lästigen Touristen-Pfl ichten. Museen, Kirchen, Oper, Theater: Och nö, muss ja nicht sein bei dem Wetter, oder? Im Gegenteil: Sommer in Berlin, das ist ein bisschen wie Schule schwänzen. Hier kann man wieder lernen, was man mit 16 noch so gut konnte: rumtrödeln, streunen gehen, es einfach dem Zufall überlassen, was der Tag so bringt.
Mein Plan war deshalb simpel: größtmögliche Planlosigkeit. Ein guter Startplatz dafür ist das "Michelberger Hotel", ein Designhotel, geboren aus dem Geist der Jugendherberge, in der Nähe der Oberbaumbrücke. Im Fernseher läuft "The Big Lebowski" in Endlosschleife ("Ist nun mal mein Lieblingsfilm", sagt Hotelbesitzer Tom Michelberger), gefrühstückt wird im Schrebergarten-Ambiente des Innenhofs in Hollywoodschaukeln und auf Campingstühlen. Zwei Neuseeländer versuchen sich gerade an ihrer ersten Weißwurst. Also, wohin soll ich als Erstes, Herr Michelberger, was ist typisch Berlin? "In den Plänterwald", sagt er, "oder ins Prinzenbad, da tobt die komplette Kreuzberg-Show. Oder setz dich einfach vor den Bagdad-Döner am Schlesischen Tor und guck, wer da so vorbeikommt." Der Plänterwald liegt gleich um die Ecke, mit dem ehemaligen DDR-Vergnügungspark darin, der seit Jahren geschlossen ist. Früher kam man nur mit etwas krimineller Energie auf das Privatgelände, heute gibt es sporadisch Führungen, aber man wird belohnt mit einer Filmkulisse sondergleichen: Umgestürzte Plastikdinosaurier und Wildwasserbahngondeln modern in einem Wäldchen vor sich hin, man fühlt sich wie Alice in einem verwilderten Wunderland. Ähnlich versteppt, aber deutlich belebter - das legendäre Prinzenbad. Wie Michelberger versprochen hatte: die Kreuzberger Badewanne. Bahnen zu schwimmen soll man besser gar nicht erst probieren, aber dazu ist ja auch keiner hergekommen. Wozu auch? Man könnte ja was verpassen: die kleinen Mackerspielchen der Türkenbubis, die Picknickorgien ihrer quasselnden, aber wachsamen Mütter auf den Deckenlagern am Beckenrand, das Schaulaufen der Kiezprinzessinnen, das Kommen und Gehen auf der räudigen Liegewiese - es ist ein Fest. Jetzt noch eine Portion "Pommes Schranke" auf die Faust, und die Seligkeit der großen Ferien hat einen wieder.
Ohnehin geht ohne Essen praktisch nichts im Berliner Sommer. Selbst wenn man sich ausnahmsweise mal Kultur verabreicht, dann nur mit der Gabel in der Hand. Beim "Classic Open Air" auf dem Gendarmenmarkt sitzen hinter den Absperrungen Damen mit Hut und zwei Pfund Perlen, fächeln sich mit dem Programm heiße Abendluft ins Dekolleté und lauschen hingerissen, wie Katja Riemann eine Filmmusik-Gala mit Wikipedia-Wissen über das Kino moderiert. Draußen, auf den Stufen zum Französischen Dom, findet dagegen die lustigere Party statt, rund um ein paar Sangria-Eimer mit zehn Strohhalmen, die zierlich auf Spitzendecken angerichtet sind, daneben Tupperdosen mit Kartoffelsalat. Und bei der "Sommernachtsopera" im Monbijoupark werden die Opern-Schmachtfetzen gleich zackig in zweimal 20 Minuten heruntergeknödelt, um die Leute ja nicht zu sehr von ihren Tellern abzulenken. Der Berliner nimmt nun mal, wie jeder gute Teenager, sein Junkfood furchtbar ernst. Ah, die epischen Debatten, die um den besten Döner, die beste Currywurst, den besten Burger, die besten Cupcakes geführt werden! Im vergangenen Jahr drehte sich der Hype um das beste Joghurteis. Gewonnen hat diese Kategorie nach Meinung vieler Matthias Schwach, der mit seinem mintgrünen Piaggio-Dreiradwagen die ambulante Eisdiele "Yo'Munchy" betreibt. Teil des Spaßes: herausfinden, wo er gerade steht. Die Schnitzeljagd findet per Facebook statt. Heute parkt er vor dem Strandbad Mitte, wie immer umringt von Fans, und der Mann von der Crèpes-Bude nebenan ruft rüber: "Matthias! Gib Gas, Mann, guck mal die Schlange!" Spätestens am dritten Tag dieser wunderbar vertrödelten Völlerei schlägt dann doch kurz das schlechte Gewissen zu. Sightseeing, na schön, muss ja auch mal sein. Aber ein bisschen flott, ja? Das geht sogar sehr flott, wenn man sich mit Michael Horstmann von "Mike's Sightrunning" verabredet. Morgens um sieben treffen wir uns in Joggingklamotten hinter dem Hauptbahnhof, dann geht es in gemütlichem Trab an der Spree entlang. Reichstag, Kanzleramt, Tiergarten, Brandenburger Tor, Unter den Linden - Stadtbesichtigung im Schnelldurchlauf. Die Wachen vor der amerikanischen Botschaft winken, die kennen den Spaß schon. Ich muss zugeben, es ist ein prickelndes Gefühl, frühmorgens im Trikot vor Angies Bürofenster auf und ab zu laufen. Hätte den Bauch einziehen sollen allerdings. Frühstück mit Beate Wedekind, der Ex-"Bunte"- Chefin, die zwischen Berlin und Ibiza pendelt. Sie ist weggezogen aus Mitte ("Ich bin einmal zu oft gefragt worden: Where is the Hackeshe Hofe?") und lebt jetzt in Kreuzberg. Wohin soll ich als Nächstes, Beate? "Strandbad Wannsee, klar. Die Admiralbrücke bei Sonnenuntergang, da hängen alle ab. Der Bücherflohmarkt auf der Museumsinsel, früh am Samstagmorgen. Da kauft Joschka Fischer ein. Die Dachterrasse von Karstadt am Hermannsplatz, toller Blick." Alles gute Ratschläge, aber ihr bester war der, auf den Friedhof in der Bergmannstraße zu gehen, da gebe es ein Mausoleum, "so was hast du noch nicht gesehen". Und so ist es. Eine kleine Totenstadt in Kreuzberg, ein Ort der Stille, über dem sich plötzlich ein Flügelhorn erhebt. Ich gehe dem Klang nach: Zwischen den Grabmälern probt ein junger Musikstudent. Nein, beschwert hat sich noch keiner, lacht er, wie auch?
Er empfiehlt als nächstes Ziel "Beach 61" , da wolle er heute Nachmittag auch hin. Noch so ein Ort, der mittendrin ist und doch ganz weit weg: Am Ende einer Holperstraße hinter einer Tankstelle und einer Autowerkstatt, genau da, wo eigentlich nichts mehr kommen kann, liegen drei Dutzend Beachvolleyballfelder auf dem alten Güterbahnareal Gleisdreieck, gerade mal einen Kilometer vom Potsdamer Platz entfernt. Auf dem Gelände soll bis 2012 ein etwa dreißig Hektar großer Park entstehen, vorerst ist davon nichts zu sehen. Aus Bierkisten und ein paar Brettern hat jemand erstaunlich bequeme Sessel gezimmert, von denen man gut gebauten Jungs mit sandigem Rücken beim Baggern zugucken kann: "Mensch, Susi! Aber schön gedacht!" Vielleicht ist dies der Grund, warum man sich in Berlin trotz Großstadtgetümmel nie eingeengt fühlt: Die Stadt ist so unfertig wie kaum eine Weltstadt und wie gewiss keine in Deutschland. Immer noch finden sich Brachen, die der Krieg oder die Mauer geschlagen haben, unbebaute Grundstücke, vergessene Orte. Abenteuerspielplätze, die die Stadt atmen lassen. Abends Treffen mit einem dieser unzähligen "Wenn du nach Berlin kommst, musst du unbedingt X treffen"-Kontakte. Max Höhn, ehemaliger Schauspieler, hat einen Friseursalon in Noto, wie die Gegend nördlich der Torstraße jetzt genannt wird - mal ironisch, mal nicht. Seine Kunden sind bekannt, bei "Promifriseur" würde er aber entsetzt abwinken. Wir schlendern die entzückende Schröderstraße, dann die Gartenstraße entlang und biegen in die Torstraße ein. Da drüben hat Brad Pitt immer gegessen während der Dreharbeiten zu "Inglourious Basterds", aha, soso. Wir sitzen lieber vor dem "Noto", essen vorzüglich von der winzigen Karte und gucken dem Wirt Ronald Marx, ebenfalls Ex- oder Immer-mal-wieder-Schauspieler, dabei zu, wie er unglaublich charmant einen Zehnertisch mit Amerikanern beflirtet. Wohin noch, Max? "Die Dachbar vom 'Hotel de Rome'. Eis von 'Annamaria' beim Kollwitzplatz, die macht sogar die Schokostreusel selbst. Der Flohmarkt am Arkonaplatz. Die 'Ankerklause' am Maybachufer. Das 'Themroc', aber das Essen dauert ewig. Das …" Und so gehen sie dahin, die Tage. Man muss nichts tun, man muss sich nur vom sanften Wellenschlag Berlins treiben lassen. Ja, klar kann man Stadtrundfahrten machen, auf Türme klettern, auf Spreedampfern fahren. Aber schöner ist es doch auf einem Liegestuhl in der "Strandbar Mitte" gegenüber der Museumsinsel, wo die Bötchen alle fünf Minuten mit quäkendem "Und links sehen Sie …" vorbeigondeln.
Am letzten Abend verabrede ich mich mit einem alten Freund, er schlägt die Modersohnbrücke in Friedrichshain als Treffpunkt vor. Die ist nichts Besonderes, einfach nur eine Brücke über eine Bahntrasse mit freiem Blick Richtung Westen. Leute sitzen auf der Abtrennung zur Fahrbahn und trinken Plastiktüten voll mitgebrachtem Bier, während die Sonne untergeht. "Und, was hast du so gemacht in Berlin?" Nichts Besonderes, sage ich. Nur ein bisschen gelebt. Wir sitzen, schweigen und sehen den S-Bahnen unter uns zu. Gucken, was kommt. Schauen, was geht.