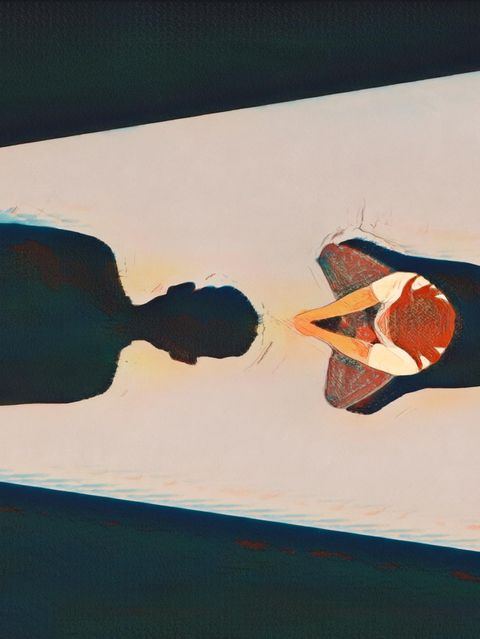A bis C
Alpha-Wellen: Alpha-Wellen sind eine besondere Form der Hirnströme. Sie können als eine Art Entspannungs-Barometer bezeichnet werden, da sie bei Zuständen tiefer Gelöstheit verstärkt auftreten. Mittels dem Elektroenzephalogramm (EEG), einer besonderen Messmethode, werden sie auf dem Bildschirm sichtbar gemacht. So wurde beobachtet, dass die Alpha-Wellen bei Entspannungs-Techniken wie Meditation zunehmen.
Akupressur: Gemäß fernöstlicher Lehren strömt die Lebensenergie Qui in 14 Meridianen durch den Körper. Im Gegensatz zur Akupunktur versucht die Akupressur den Energiefluss nicht durch stechen, sondern durch sanften Druck und Massagen zu beeinflussen. Damit sollen Beschwerden wie Abgespanntheit, Schlafstörungen oder Kopfschmerzen gelindert werden.
Akupunktur: Vor rund 4000 Jahren wurde die Akupunktur in China entwickelt. Mit Nadeln aus Stahl, Silber und Gold werden bestimmte Punkte des Körpers stimuliert. So soll der Fluss der Lebensenergie Qui beeinflusst werden. In Europa wird die Akupunktur seit rund 40 Jahren angewandt, unter anderem gegen Schlafstörungen oder Migräne.
Algenbäder/Algenwickel: Packungen und Bäder aus meist pulverisierten Algen werden besonders in der Thalasso-Therapie angewandt. Mineralien und Spurenelemente in den Algen sollen die Haut pflegen und revitalisieren.
Aromatherapie: Ätherische Öle werden aus Blüten, Blättern, Wurzeln oder dem Harz von Pflanzen gewonnen. Die Öle werden als Badezusätze verwendet, in Aromalampen verdampft, inhaliert, oder einmassiert. Einige wirken entspannend, andere anregend. Die Husten lösende Wirkung etwa von Thuja- oder Zitronenöl gilt als erwiesen.
Atemtherapie: Besonders nach der indischen Yoga-Lehre ist richtiges Atmen die Voraussetzung für geistige, körperliche und seelische Gesundheit. In Japan und China bilden Atem- und Bewegungsübungen einen Schwerpunkt der körperlichen und geistigen Gesundheitsvorsorge. Bewusste, gleichmäßige Atmung kann helfen, Spannungen abzubauen.
Autogenes Training: Autogenes Training soll Verspannungen in Körper und Geist lösen. In einer Art Selbsthypnose versuchen die Übenden, Wärme und Schwere in unterschiedlichen Körperteilen zu spüren. Autogenes Training kann bei Schlaflosigkeit, Ängsten oder psychischer Belastung helfen. Aber auch körperliche Beschwerden wie Verspannungen und Migräne lassen sich damit behandeln. Bei Depression und Epilepsie wird von Autogenem Training abgeraten.
Ayurveda: Nach der altindischen "Wissenschaft vom Leben" bestimmen drei Prinzipien den menschlichen Organismus, die Doshas: Vata regelt Bewegung und Nerventätigkeit, Pita reguliert den Wärmehaushalt und den Stoffwechsel, Kapha reguliert das Immunsystem und den Flüssigkeitshaushalt. Durch Ernährungskuren, Ölgüsse, Kräuter-Saunen und Synchronmassagen sollen alle drei Prinzipien ins Gleichgewicht gebracht werden.
Badekur: Warmes, mineralreiches Wasser ist Grundlage für die heilende Kraft dieser Kur, die alle Heilmethoden eines Kurortes umfasst, nicht nur das Baden in einer Therme. Auch ein Bad in der eigenen Wanne kann Wunder wirken: Empfehlenswert ist dabei eine Temperatur von etwa 35-37° C, damit der Kreislauf wenig belastet wird. Optimale Badedauer: 20 Minuten.
Balneo-Therapie: Bei der Balneo- oder Bädertherapie wird der Körper mit Heilwässern (Trinkkuren), Heilpeloiden (Moor und Schlamm), Wasser (Hydrotherapie, Medizinische Bäder), Kälte und Wärme (Kneipp-Kur) oder Inhalationen behandelt. Auch verändertes Klima kann eine Genesung unterstützen (z.B. Klimatherapie an der Küste). Eine balneologische Kur dauert drei bis vier Wochen und lindert chronische Leiden und psychische Belastung.
Bewegungstherapie: Sport und Bewegung beugen Zivilisationskrankheiten vor. Bei der Bewegungstherapie geht es vor allem darum, bestimmte Muskelgruppen zu kräftigen und zu koordinieren, z.B. durch sanfte Muskelspiele, Ausdauertraining und Dehnübungen. "Spitzenleistungen" durch Kraftsport oder Bodybuilding sind nicht erwünscht. Zu empfehlen sind: Schwimmen, Wandern, Joggen, Walken, Skilanglauf.
Bio-Rhythmus: Viele Funktionen des Körpers unterliegen rhythmischen Veränderungen, die zum Teil von äußeren, biologischen Zeitgebern gesteuert werden. Dazu zählen etwa Sonnenlicht oder Temperatur. Wer möglichst gut im Einklang mit seinem biologischen Rhythmus leben will, sollte seinen Tagesablauf nach seiner inneren Uhr ausrichten. Wer Mittags oft müde ist, sollte besonders wichtige Aufgaben besser am Vormittag erledigen.
Bürstenmassage: Mit Naturfaser-Bürsten und Luffa-Handschuhen wird der Körper in kreisförmigen Bewegungen massiert; von der Fußsohle über den Fußrücken, den Knöchel, den Unter- und Oberschenkel, die Hüfte und den Po, immer in Richtung Herz. Anschließend werden Finger, Arme und Schultern gebürstet. Die Massage wirkt kreislaufanregend und durchblutungsfördernd.
Caldarium: Im Heißbaderaum der römischen Thermen ist es rund 50 Grad warm und die Luft ist sehr feucht - ein ideales Klima, damit die Poren der Haut sich öffnen. Der Stoffwechsel wird behutsam angeregt und die Atemwege werden frei.
Chi Kung: Andere Schreibweise für Qi Gong
Chronobiologie: Chronobiologie ist die Lehre von der Veränderung des Körpers mit den Tages- und Jahreszeiten. Die relativ junge Wissenschaft beschäftigt sich mit Erscheinungen wie Frühjahrsmüdigkeit und Winterdepressionen. Einige Medikamente sollen besser wirken, wenn sie zu bestimmten Tageszeiten eingenommen werden. Zur Chronobiologie gehört auch der (->) Bio-Rhythmus.
Cleopatra-Bad: Der Legende nach soll die ägyptische Herrscherin Cleopatra in Eselsmilch gebadet haben, um ihren schönen Körper zu pflegen. Wenn heute Cleopatra-Bäder angeboten werden, handelt es sich meistens um ein luxuriöses Wannenbad mit Öl- und Milchzusätzen. Meistens kommt die Milch dazu von der Kuh.

D bis H
Danarium: Das Danarium ist ein Dampfbad für Menschen, die große Hitze und sehr feuchte Luft schlecht vertragen, besonders Herz-Kreislauf-Patienten. Die Temperatur liegt bei moderaten 65 Grad, die Luftfeuchtigkeit bei 60 Prozent.
Eiswickel: Eiswickel werden besonders in der Thalasso-Therapie angewandt. Die kalten Wickel sollen Stoffwechsel und Durchblutung anregen. Dadurch sollen Wirkstoffe aus Algenwickeln besser über die Haut aufgenommen und das Gewebe gestrafft werden.
Erlebnisdusche: Wasser aus unterschiedlichen Düsen massieren den Körper sanft oder kräftig. Die Erlebnisdusche belebt Haut, Körper und Geist.
Ernährung: Fast jede Wellness-Schule wird von einem eigenen Ernährungsprogramm begleitet. Je exotischer und teurer die Diät, desto attraktiver wirkt sie auf viele Kunden. Ernährungsexperten raten dagegen zu einer leichten Mischkost, die jeder einfach selbst zusammenstellen kann: wenig Fett, viel Gemüse und frisches Obst, Kohlenhydrate nicht als Zucker, sondern am besten in Vollkorn-Getreide.
Fango-Kur: Bei der Fango-Kur wird Mineralschlamm erhitzt, auf Plastikfolie gegossen und bei einer Temperatur von ungefähr 50 Grad um den Körper gepackt. Die Patienten schwitzen während der Behandlung stark, die Gefäße weiten sich und der Blutkreislauf wird beschleunigt. Fango-Kuren sollen rheumatische Beschwerden und Verspannungen lindern. Bei Bluthochdruck und Herzerkrankungen können Fango-Packungen auch negativ wirken.
Farbtherapie: Bei der Therapie wird die so genannte "Mangelfarbe" bestimmt: Ihr werden bestimmte Wirkungen zugeschrieben, die gegen die individuellen Leiden des Patienten helfen sollen. Ihrem Licht wird der Patient etwa eine halbe Stunde ausgesetzt. Gelb- und Rottöne sollen stimulieren, Grün soll die Kreativität beflügeln, Gelb soll entspannend wirken, Blau soll Schmerzen lindern. Die Farbtherapie kann als Mittel gegen Stress wirksam sein. Erfolge sind jedoch nicht sicher belegt.
Fasten: Verzicht auf feste Nahrung und Genussmittel für begrenzte Zeit. Wichtig ist, dass der Fastende dabei viel Flüssigkeit zu sich nimmt wie Gemüsebrühen, Obst- und Gemüsesäfte, Tees und Wasser. Auf Alkohol, Nikotin, Kaffee und Süßigkeiten wird verzichtet. Der Fastende sollte sich von einem Arzt beraten lassen.
Felkekur: Diese Therapie ist nach dem Naturarzt Emanuel Felke benannt. Dabei werden alle Heilkräfte der Natur genutzt: Erde, Wasser, Luft und Wärme. Bei der Fekekur werden Lehm-Packungen, Sauna-Gänge, Wassergüsse und ein vielfältiges Bewegungsprogramm angewendet. Für die erfolgreiche Felkekur ist auch eine vollwertige Ernährung wichtig.
Feng-Shui: Die Chinesische Lehre vom harmonischen Leben und Wohnen. Feng-Shui gründet auf der Weisheit, dass Menschen nur gesund und glücklich sind, wenn ihr Lebensumfeld mit ihrer Lebensenergie im Einklang ist. Die Räume werden so gestaltet, dass sie ein gutes Feng-Shui erzeugen. Feng-Shui ist eine Modeerscheinung, die mittlerweile wie eine Wissenschaft betrieben wird. Zum "Feng Shui Berater" kann man sich jedoch in ein paar Wochen ausbilden lassen.
Float Cabine: Eine eiförmige Ein-Personen-Kabine, die mit warmem Wasser und Bittersalz gefüllt ist. Durch das Salz treiben die Benutzer an der Wasseroberfläche. Dadurch wird die Entspannung gefördert.
Fünf Tibeter: Abfolge von fünf relativ einfachen Körperübungen. Die Übungen versprechen Ruhe und Konzentration. Die fünf "Tibeter" sollten täglich etwa eine halbe Stunde praktiziert werden. Die Ausführung der Übungen sollte von einem Bewegungstherapeuten geschult und angeleitet werden. Nicht alle Übungen sind bei Erkrankungen bedenkenlos zu empfehlen.
Fussreflexzonen Massage: Die Fußsohle ist in Reflexzonen unterteilt, die andere Regionen des Körpers widerspiegeln und über Reflexbahnen mit ihnen verbunden sind. Wenn diese Zonen an der Fußsohle stimuliert werden, wirkt sich das positv auf die zugeordneten Körperregionen aus. Durch die Massage sollen die Selbstheilungskräfte gefördert werden.
Hamam: Ein türkisches oder orientalisches Bad. Der Gast wird während der Hamam-Prozedur durch vier Räume geführt: Die Temperatur wird in den Räumen langsam gesteigert, so dass der Körper stetig erwärmt und der Kreislauf nicht zu sehr belastet wird.
Heubad: Wärmebehandlung, bei der Heu erhitzt wird. Dadurch wird der Körper sanft zum Schwitzen gebracht , um ihn zu entgiften und zu entschlacken.
J bis P
Jacuzzi: Unterwassermassagetechnik, die den Körper entspannt. Entspricht etwa dem Whirlpool.
Kaiserbad: Entspannung in einer luxuriösen, goldglänzenden Wanne aus massiver Bronze. Das Kaiserbad wurde von der Wellness-Industrie in den 90er Jahren erfunden. Die Wanne ist mit Whirlpools ausgestattet. Kräuter sollen zusätzliche Entspannung bringen.
Klangmassage: Bei einer Klangmassage werden mehrere Schalen auf den bekleideten Körper gelegt und angeschlagen. Bei einer Variante der Massage liegt der Patient im Wasser. Feine Vibrationen sollen Körper, Geist und Seele berühren und von Spannungen lösen. Dabei sollen Selbstheilungskräfte mobilisiert und schöpferische Energien freigesetzt werden.
Kneipp-Kur: Das Kneippsche Naturheilverfahren setzt sich aus fünf Fundamenten zusammen: Wasseranwendungen, Heilkräuter, Bewegung, gesunde Ernährung und Lebensordnung. Diese Behandlungsverfahren werden je nach Erkrankung unterschiedlich kombiniert. Besonders berühmt sind die Kneippschen Kaltwasser-Güsse, die den Körper abhärten sollen.
Kraxenofen: Im Kraxenofen wird Heu schonend erwärmt. Das löst eine Substanz des Waldmeisters auf, die über die Haut und die Atemwege aufgenommen wird. Die Anwendung wirkt entspannend und schont Herz und Kreislauf.
Laconium: Trockener Schwitzraum nach altrömischem Muster. Die Wärme strahlt vom Boden, von den Wänden und von den Steinbänken ab. Bei rund 60 Grad kommt der Körper langsam ins Schwitzen. Ein Schwitzgang dauert etwa 15 Minuten. Eine gute Alternative für Menschen, denen die klassische Sauna zu heiß ist, etwa für Herz-Kreislauf-Patienten.
Leberwickel: Bei vielen Kuren spielen Entgiftung und Entschlackung eine zentrale Rolle. Durch warme feuchte Tücher und Kräuterwickel soll die Leber als wichtigstes Organ zur Blutwäsche bei ihrer Tätigkeit unterstützt werden. Oft wird die Anwendung durch farbiges Licht begleitet. Die Wirkung dieser Behandlung wie auch die Bedeutung von Entschlackungskuren selbst sind wissenschaftlich umstritten.
Liquid Sound: Der Besucher schwebt wie schwerelos in warmem Salzwasser. Sphärische Klänge wabern durch den Raum, farbiges Licht pulsiert und entspannende Bilder werden an die Decke projiziert. Zweifellos eine angenehme Umgebung, um sich zu entspannen. Darüber hinaus ist keine Wirkung nachgewiesen.
Lymphdrainage: Ähnlich wie die Blutbahnen durchzieht das Lymphsystem den ganzen Körper. Es leitet die Stoffwechselprodukte an das Blut weiter. Staut sich die Lymphe, kann das sehr schmerzhaft sein. Bei der Lymphdrainage werden die Lymphbahnen mit kreisenden und streichenden Bewegungen massiert. So sollen Stauungen aufgelöst werden. Medizinisch ist eine Lymphdrainage nur sinnvoll, wenn sie regelmäßig über mehrere Monate angewandt wird.
Massage: Die Massage wurde schon im Altertum eingesetzt. Im Mittelalter verlor die Massage durch den Einfluss der Kirche an Bedeutung. In der neueren Zeit wurde die Massage durch wissenschaftliche Untersuchungen wiederentdeckt. Die klassische Massage behandelt in erster Linie Muskelverspannungen. Auch Kopfschmerzen und Erschöpfungs-Symptome können durch Massagen behoben werden. Positive Effekte werden erst bei mehrmaliger Anwendungen erreicht.
Moorbad: Moor nimmt Wärme gut auf und gibt sie langsam an den Körper ab. So kommt eine langsame, lang anhaltende Wärmewirkung zustande, die tief in den Körper eindringt. Nach dem Moorbad verflüchtigt sich die Hitze im Körper nur langsam. Außer bei entzündlichen Erkrankungen sind Moorbäder sinnvoll, weil Wärme als schmerzlindernd und heilend empfunden wird.
Peeling: Mit körnigen Cremes, Lotionen oder Meersalz werden überschüssige Hornhaut und Schuppen am Körper, vor allem im Gesicht, abgeschält. Die Haut wird dadurch reiner und kann andere Pflegeprodukte besser aufnehmen. Peelings werden oft in Wellness-Kuren eingesetzt; günstige Peelingcremes für zu Hause gibt es aber auch in Drogerien und Supermärkten.
Physikalische Therapie: Sammelbegriff für verschiedene Formen der Naturheilkunde: Massage, Gymnastik, Wärme- und Kältebehandlung, Wickeltherapien.
Pizichil: Ein ayuverdisches Ölbad. Die Behandlung beginnt mit einer Ganzkörpermassage, die mit angewärmten Öl durchgeführt wird. Danach wird der Körper auf beiden Seiten mit erhitztem Öl begossen. Langsam erwärmt sich der Körper und beginnt zu schwitzen. Schadstoffe sollen dabei nach außen befördert werden.
Q bis S
Qi Gong: Atem- und Energieübungen, die auch als Chi Kung oder Qui Gong bezeichnet werden. Qi Gong gehört zur Traditionellen Chinesischen Medizin. Es soll die Haltung verbessern, Verspannungen lösen und die Konzentrationsfähigkeit stärken. Die Übungen gelten als leicht erlernbar.
Rasulbad: Das Rasulbad ist eine alte ägyptische Form des Dampfbads. Heilerde, Algen und Kreide werden auf dem Körper verteilt und einmassiert. Langsam steigt die Temperatur, Kräuterdampf erfüllt den Raum. Das Rasulbad soll die Durchblutung anregen und das Immunsystem stärken.
Reiki: Reiki ist eine alte tibetanische Form des Heilens. Sie geht davon aus, dass das Universum mit unerschöpflicher Energie gefüllt ist. Diese wird durch die Hände des Reiki-Meisters weitergegeben. Körper und Geist kommen ins Gleichgewicht und die Lebensenergie wird gestärkt. Die Reiki-Methode wurde schon vor 2500 Jahren in alten buddhistischen Schriften erwähnt und im 19. Jahrhundert durch. Mikao Usui, einen christlichen Priester, in Japan neu entdeckt.
Römisches Bad: Das Römische Bad knüpft an die Badekultur der Antike an. Drei feuchte Räume werden durchlaufen, in jedem wird es ein bisschen wärmer: 1. das Tepidarium (Warmbad, bis 39 Grad); 2. das Caldarium (Heißbad, 40 bis 50 Grad, Luftfeuchtigkeit bis 100 Prozent, die Luft ist angereichert mit ätherischen Ölen); 3. das Lanconicum (Intensivraum, 55 bis 60 Grad). Im Frigidarium kühlt man sich ab.
Sanarium: Das Sanarium, auch Bio-Sauna oder Danarium genannt, ist eine gemäßigte, kreislaufschonende Sauna. Die Luft ist nicht so heiß und nicht so feucht. Es wird höchstens 60 Grad warm, die Luftfeuchtigkeit beträgt nicht mehr als 60 Prozent. Oft wird das Sanarium kombiniert mit der Farblicht-Therapie.
Schröpfmassage: Beim Schröpfen werden auf dem Rücken bis zu zehn Schröpfköpfe aufgesetzt. Durch Abbrennen eines benzingetränkten Wattebauschs an den Schröpfköpfen wird ein Vakuum erzeugt, der Sog auf der Haut weitet die feinen Blutgefäße und es entstehen blaue Flecke. So sollen Muskelschmerzen, Durchblutungsstörungen und Rückenschmerzen gelindert werden. Schröpfen war besonders im Mittelalter sehr populär, teilweise auch in der blutigen Variante - die Haut wurde unter dem Schröpfkopf kreuzförmig eingeritzt. Generell sind Massagen dem Schröpfen vorzuziehen.
Shiatsu: Shiatsu ist eine japanische Massagetechnik und beruht auf der Akupunktur und der Akupressur. Bei der Therapie werden bestimmte Druckpunkte des Körpers mit Daumen, Händen, Ellbogen oder auch Knien massiert. Dadurch sollen der Fluss der Körperenergie wieder geordnet und Glückshormone freigesetzt werden. Zur Behandlung liegt der Patient in der Regel auf dem Boden. Ziel der Behandlung ist es, erste Anzeichen von möglichen Krankheiten zu kurieren.
Shi-Tsubo-Magnetopunktur: Beim Shi-Tsubo ist ein asiatisches Akupressur-Verfahren. Hierbei werden die im Körper vermuteten Energielinien durch Druckpunktmassage mit der Hand aktiviert. Außerdem werden Magneten eingesetzt. Sie werden auf die Energielinien im Gesicht aufgelegt - ähnlich wie Akupunkturnadeln. Beides zusammen soll Entspannung und körperliches Wohlbefinden erzeugen.
Spa: Spa setzt sich zusammen aus den Initialen des lateinischen Sanus per aquam - auf deutsch: Gesundheit durch Wasser. Der Begriff greift die antike Bäderkultur auf. Spa-Einrichtungen bieten Wellness-Behandlungen rund ums Wasser, etwa Dampfbäder, Kneipp-Kuren oder Thalassobehandlungen. Die ersten Spa-Hotels entstanden in den USA. Sie lockten mit den Methoden europäischer Kur- und Bäderbetriebe. Als linguistischer Re-Import kehrte der Begriff vor einiger Zeit nach Deutschland zurück.
Stangerbad: Das Stangerbad nutzt die Leitfähigkeit des Wassers, um dem Körper geringe Mengen Strom zuzuführen. Das löst ein angenehmes Kribbeln aus. Der Patient liegt dazu in einer Wanne, in der Elektroden angebracht sind. Der Strom soll Schmerzen lindern, etwa bei Rheuma oder Hexenschuss. Das Stangerbad ist benannt nach dem Gerbermeister Johann Jakob Stanger, der das Prinzip als erster verwendete. Es wird heute in der Physiotherapie angewandt.
T bis Z
Tai Chi: Tai Chi ist eine meditative Bewegungskunst, die ihre Wurzeln in China hat. Der Legende nach begründete der Mönch Chang San-Feng vor mehr als 2000 Jahren Tai Chi als praktische Anwendung der Erkenntnisse des Taoismus. Früher wurde Tai Chi auch als Selbstverteidigung genutzt. Heute ist das kämpferische Element in den Hintergrund gerückt. Daher wird Tai Chi häufig auch als Schattenboxen bezeichnet. Charakteristisch für Tai Chi ist die sehr langsame Ausführung der Bewegungsfolgen. Wissenschaftliche Studien haben belegt, dass Tai Chi nicht nur die Wahrnehmung des eigenen Körpers unterstützt, sondern auch zum Erhalt der Knochendichte beiträgt.
Thalasso-Therapie: Thalassa ist das griechische Wort für Meer. Bereits im Altertum nutzten die Griechen das Meerwasser zu Heilzwecken. Inzwischen ist daraus eine Behandlung rund ums Meer geworden - mit Algen- und Fango-Packungen, Massagen und Wanderungen am Strand. Thalasso-Zentren dürfen höchstens 300 Meter vom Meer entfernt sein. Die Therapien sollen Gelenkschmerzen lindern, Sportverletzungen heilen, die Haut straffen und das Immunsystem stärken.
Thermalbad: Vor allem die alten Römer vertrauten auf die entspannende Wirkung von Thermalbädern, der Begriff jedoch stammt aus dem Griechischen: Therm bedeutet warm. Heute werden an Thermalwasser bestimmte Anforderungen gestellt: Es muss aus mehreren tausend Metern Tiefe kommen und eine natürliche Temperatur von mindestens 20 Grad Celsius haben. Beim Thermalbad ist der Badende normalerweise vollständig im Wasser. Die Wärme wirkt schmerzlindernd und entzündungshemmend; die Muskeln entspannen sich und das Bindegewebe wird elastischer. Zusätzlich lindern die mineralischen Bestandteile des Wassers chronische Erkrankungen wie Rheuma oder Allergien.
Traditionelle Chinesische Medizin (TCM): Die Traditionelle Chinesische Medizin geht von folgendem aus: Wichtig ist nicht, dass Organe, Knochen, Muskeln und Nerven reibungslos funktionieren - sondern dass die Lebens-Energie "Qi" ungehindert fließt. Die beiden im Körper wirkenden Kräfte Yin und Yang müssen im Gleichgewicht sein. Zur TCM zählen unter anderem Heilkräutertherapie, Akupunktur und die Meditations- Bewegungslehren Qi Gong und Tai Chi.
Trinkkuren: Noch im 19. Jahrhundert waren Trinkkuren, also das bewusste Trinken von Heilwasser, ein häufig angewandtes therapeutisches Mittel. Später wurden Trinkkuren von Medikamente verdrängt. In jüngster Zeit vertrauen Ärzte wieder auf die heilende Wirkung des Wassers. Die therapeutischen Heilwirkungen von Trinkkuren sind wissenschaftlich belegt. Heilwässer mit hohen Hydrogencarbonat-Gehalt lindern zum Beispiel chronische Magenschleim-haut-Entzündungen, stark sulfathaltige Wässer regen Galle und Bauchspeicheldrüse an.
Vollwert: Vollwertige Ernährung, Vollwert-Ernährung und Vollwertkost klingen sehr ähnlich - bezeichnen jedoch drei unterschiedliche Ernährungskonzepte. Die vollwertige Ernährung basiert auf den Nährstoffempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Im Vordergrund steht die schonende Zubereitung des Essens, das zudem möglichst wenig verarbeitet sein sollte. Bei der Vollwert-Ernährung soll sich die Auswahl der Lebensmittel zudem nach ökologischen Kriterien und der Sozialverträglichkeit ihres Anbaus richten. Das Konzept der Vollwertkost lehnt jede Behandlung von Lebensmitteln wie etwa Erhitzen ab. Alle drei Ernährungstheorien haben das gleiche Grundproblem: Aufgrund ihres Allgemeinheitsanspruchs werden die unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen kaum berücksichtigt.
Wellness: Der Begriff Wellness taucht erstmals 1654 im englischen Sprachraum auf, wurde aber in seiner ursprünglichen Bedeutung nie so gebräuchlich wie sein Antonym illness - Krankheit oder Unwohlsein. Er umfasst körperliches und emotionales Wohlbefinden. Heute werden unter dem Schlagwort Wellness alle möglichen Produkte und Methoden angeboten, mit denen sich die Kunden verwöhnen sollen.
Wickel: Wickel sind ein altes Hausrezept. Am bekanntesten sind Wadenwickel, die bei Fieber eingesetzt werden: Ein lauwarmes feuchtes Tuch wird um die Waden gewickelt, damit es dem Körper Wärme entzieht. Sobald sich das Tuch spürbar erwärmt, muss der Wickel gewechselt werden.
Yoga: Yoga ist zugleich ein philosophisches System und eine praktische Methode. Seine Ursprünge liegen im alten Indien. Ziel ist innere Freiheit und Zufriedenheit - alle seelischen Vorgänge sollen zur Ruhe kommen, so dass der Yoga-Treibende den Grund des eigenen Wesens erblickt kann. Im Laufe der Zeit haben sich eine Vielzahl von Yoga-Richtungen entwickelt. Sie stellen jeweils bestimmte Aspekte in den Vordergrund. In der westlichen Welt wird am häufigsten das Hartha-Yoga praktiziert, das sich vor allem der Körperhaltung widmet. Durch verschiedene Körperstellungen und Atemtechniken soll der Mensch seinen Körper und die Seele entdecken. Medizinische Studien haben die Heilerfolge von Yoga belegt; auch Krankenkassen zeigen sich dem Hartha-Yoga aufgeschlossen.
Zen: Zen ist japanisch und bedeutet Versunkenheit, Meditation. Es ist eine Strömung des Mahayana-Buddhismus. Der Einzelne wirkt darauf hin, allen Lebewesen den Weg zur Erleuchtung zu ebnen. Zen geht zurück auf den Buddha Siddharta. Seine Lehre breitete sich ab dem 6. Jahrhundert von Indien nach China aus und erreichte im 12. Jahrhundert Japan.