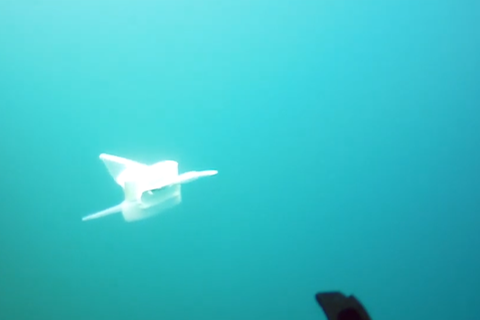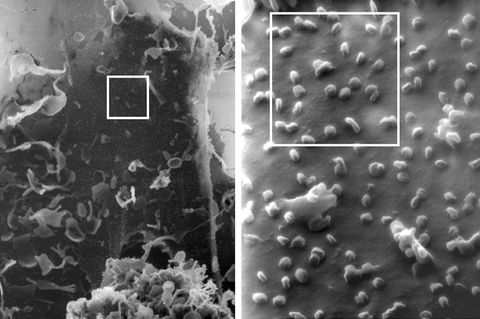Was Holger Giebel macht, ist nicht normal. Im Biotop des deutschen Ingenieurs, in dem nur Stahl und Beton als zuverlässig gelten, geht er mit einem Material auf Kundenfang, das faulen, brennen und brechen kann. Giebel will den Ingenieuren Holz verkaufen, weiches Fichtenholz, wie es für Pellets und Paletten verwendet wird, auch für Möbel. Giebel aber will 100 Meter hohe Türme aus diesem Holz bauen. Für Windräder.
Giebel ist Geschäftsführer der Hannoveraner Start-up-Firma TimberTower. Er weiß, dass sein hölzerner Turm in der Windkraftbranche auf Skepsis stößt. Aber er weiß auch, dass sein Produkt Probleme dieser Branche lösen könnte. "Als wir 2008 anfingen, den Turm zu entwerfen, war abzusehen, dass Windkraftanlagen immer größer werden", sagt Giebel. "Weil der Stahl, den man benötigt, so stark im Preis schwankt, haben wir ein alternatives Material gesucht." Und Holz gefunden.
Seit Ende 2012 drehen sich in einem Industriegebiet am Stadtrand von Hannover die Flügel eines funktionsfähigen Prototyps. Von außen unterscheidet sich der Turm kaum von einer üblichen Windkraftanlage; es ist eine schlanke, mit einer kräftigen Kunststofffolie verkleidete Röhre, die auf einem soliden Fundament aus Beton steht, 100 Meter groß, etwa so hoch wie die Türme der Münchner Frauenkirche. Das Windrad obenauf, samt Flügeln, Generator und Maschinenhaus, ist ein handelsübliches Modell des deutschen Herstellers Vensys.

Windkraftanlagen gelten nicht als Bauwerke
Erst die Fahrt mit dem Aufzug, der im Innern aufwärtsruckelt, zeigt, dass dieser Turm anders ist: Der Weg an die Spitze gemahnt weniger an die klamme Betonkühle einer Fußgängerunterführung als an eine Alpenhütte: achteckig zwar und außergewöhnlich hoch, aber in einem hellen, warmen Holzton, die Luft gewürzt von Fichtenduft.
Jahrhundertelang war Holz der typische Baustoff für Windräder, die früher freilich keinen Strom erzeugten, sondern Mahlsteine antrieben. Erst im 20. Jahrhundert verdrängten Stahl und Beton das Holz. Es sei, so fortan die Meinung unter Ingenieuren, ein schwacher, anfälliger Werkstoff. Giebel sieht das anders. Die 30 Zentimeter starken Platten aus kreuzweise verleimtem Fichtenholz lässt er mit Dachfolie versiegeln, Wasser perlt an ihnen ab. Den Entwurf hat der TÜV auf Statik und Materialsicherheit, die Bauaufsicht auf Brandsicherheit geprüft. Jahrhundertelang stehen bleiben muss der hölzerne Turm ohnehin nicht: Windkraftanlagen gelten nicht als Bauwerke, sondern als Maschinen mit begrenzter Betriebserlaubnis. Nach 20 Jahren muss der Betreiber die Anlage - unabhängig vom verwendeten Material - wieder abbauen. Das Argument, mit dem Giebel Stromkonzerne und Anlagenbauer überzeugen möchte, ist freilich nicht Nostalgie. Er sieht drei Vorteile gegenüber Stahl und Beton: einen ökologischen, einen wirtschaftlichen und einen logistischen.
Die für einen 100-Meter-Turm benötigten 250 Tonnen Stahl herzustellen, belastet die Umwelt mit etwa 340 Tonnen CO2, die Transportkosten nicht eingerechnet. Die ungefähr 800 schnell wachsenden Fichten (ein bis zwei Hektar Wald) für einen TimberTower dagegen entziehen der Atmosphäre in der Wachstumsperiode Kohlendioxid. Zwar sind Fichten-Monokulturen bei Ökologen unbeliebt. Doch noch bedecken die "Brotbäume der Forstwirtschaft" ein gutes Viertel der rund elf Millionen Hektar deutscher Waldfläche.
Holz ist leichter und günstiger
Der zweite Vorteil, so Giebel, sei der Preis - jedenfalls in Zukunft. In einer Serienproduktion von mindestens 100 Türmen könnte ein TimberTower um zehn bis 20 Prozent billiger sein als ein vergleichbares herkömmliches Modell. "Anders als Stahl ist Holz auch keinen so heftigen Preisschwankungen unterworfen", so Giebel.
Vor allem aber ist es beim Transport überlegen. Bei den herkömmlichen Türmen besteht der schlanke obere Teil aus Stahl und der kräftigere untere aus Beton. Jeder Turm wird aus vorgefertigten Ringen zusammengesetzt, die am Stück an die Baustelle gelangen müssen. Der Durchmesser der Teilstücke darf also nicht höher sein als die niedrigste Brücke auf dem Weg dorthin - in Deutschland sind das in der Regel 4,20 Meter. Die ständig in die Höhe wachsenden Windräder brauchen jedoch, um stabil zu stehen, immer dickere Fußstücke aus
Beton - das begrenzt ihr Wachstum. In manchen dünn besiedelten Gegenden der USA, Skandinaviens oder Chinas mangelt es zudem an ausreichend befestigten Straßen für Schwertransporte, um die tonnenschweren Bauteile an die oft entlegenen Standorte zu bringen.
Der TimberTower dagegen wird aus 30 Zentimeter starken Holzplatten zusammengesetzt, die leichter und kompakter sind als Betonringe - knapp 15 Meter lang und höchstens knapp drei Meter breit. Sie lassen sich auf der Ladefläche eines Lastwagens stapeln und auf normalen Straßen transportieren.
Kein Vertrauen in Holz
Bislang hat Giebel jedoch noch keinen TimberTower verkauft. Denn erst ab einer Höhe von deutlich über 100 Metern nehmen Materialkosten und Transportprobleme herkömmlicher Türme derart zu, dass Holz zur überlegenen Alternative wird. Kunden, die leistungsfähigere Windräder einsetzen wollen, müssen auf den 140 Meter hohen Holzturm warten, den TimberTower derzeit erprobt. Potenzielle Kunden zögerten aber auch, so Giebel, weil die Energiebranche so maschinenbaulastig sei: "Man traut dem Werkstoff Holz nichts zu."
Dabei ist Holger Giebel mit seiner Vorliebe für das natürliche Material schon lange kein Außenseiter mehr. In der Bauwirtschaft etwa ist die Holz-Renaissance schon wesentlich weiter fortgeschritten. Seit Mitte der 1990er Jahre sei in Deutschland der Anteil von Holz als Baustoff für Einfamilienhäuser von fünf auf etwa 20 Prozent gestiegen, sagt Heinrich Köster, Professor für Holzbautechnik an der Hochschule Rosenheim. "Ich bin überzeugt, dass er auf 20 Prozent wachsen kann", so Köster. Zwar sei Holz ein etwas teurerer Werkstoff als eine Mauer aus Backstein und Mörtel. Dafür könnten Häuser aus vorgefertigten hölzernen Wandelementen - oft schon vom Hersteller mit Dämmung, Fassade, Fenstern und Türen ausgestattet - vier- bis fünfmal schneller errichtet werden. 15 000 Holzhäuser seien 2012 in Deutschland so entstanden, sagt Köster.
Und auch mit seinem Himmelsstreben steht Holger Giebel von TimberTower nicht allein da: In der Schweiz wird bereits fast jedes fünfte mehrgeschossige Haus aus Holz errichtet. In Dornbirn/Vorarlberg steht ein anderer Holzbau der Superlative. Die österreichische Cree GmbH hat dort ihr Bürogebäude "Life Cycle Tower One" mit acht Stockwerken errichtet.