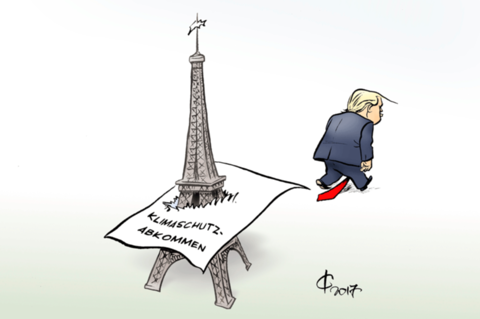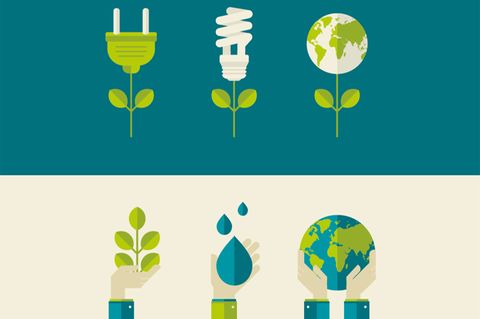Ein Klick - und wenige Tage später steht der Paketbote mit den neuen Schuhen, dem neuen Smartphone vor der Tür. Schon seit Jahren boomt der Handel via DHL, Hermes und Co. Gerade zu Weihnachten fluten die Sendungen geradezu die Versandzentren. 2019 erreicht der Online-Handel voraussichtlich einen Umsatz von 72 Milliarden Euro, die Zuwächse sind zweistellig. Bequem ist das Online-Geschäft für die Käufer allemal. Aber ist es auch gut für Umwelt und Klima?
Das Freiburger Öko-Institut nahm schon 2015 beispielhaft ein Paar Schuhe unter die Lupe – und verglich die Emissionen, die beim traditionellen Shopping im Laden oder bei einem Kauf via Internet anfallen. Das Ergebnis scheint zunächst verblüffend: So verursacht nach den Hochrechnungen der Freiburger ein Einkauf per Fahrrad im Kaufhaus mehr Emissionen als der Online-Kauf derselben Schuhe. Und zwar fast das Doppelte: 1270 Gramm statt 660 Gramm CO2. Dass die Bilanz des traditionellen Ladenkaufs so ernüchternd daherkommt, liegt nicht am Fahrrad – sondern am Energieverbrauch für Heizung und Licht im Offline-Shop.
Ein klares Votum für den Onlinehandel? Leider nein. Ein Grund dafür ist die wachsende Flut von Retouren. Produkte werden teilweise mehrfach zurückgeschickt, weil sie nicht passen oder anders aussehen als auf dem Bildschirm. Und da die meisten Online-Händler Retouren inzwischen kostenlos anbieten, wird der Service auch immer beliebter. 490 Millionen Pakete gingen im Jahr 2018 an den Absender zurück. Und innerhalb von nur zwei Jahren wuchs die Zahl der Retouren um 20 Prozent: schneller als der Online-Handel selbst.
Das ist schlecht fürs Klima: Denn die Emissionen, die für den Transport ins Umschlagzentrum, bei der Aufbereitung und beim Neuversenden entstehen, machen etwa bei den Schuhen, die das Öko-Institut bilanziert hat, schon mehr als die Hälfte der Gesamtemissionen ohne Retoure aus. Gerade im Mode-Bereich gehen besonders viele Artikel zurück – nach Branchenschätzungen rund die Hälfte aller Sendungen.
Keine generelle Empfehlung möglich
Die Summe der Emissionen ist allerdings von so vielen weiteren Variablen abhängig, dass eine generelle Empfehlung zu Online- oder Offline-Shopping nicht möglich ist.
So geht das Paket auch zurück, wenn der Bote zuhause niemanden antrifft. Dann gibt es entweder einen oder sogar mehrere neuen Zustellversuche – oder der Besteller muss die Sendung selbst abholen. Möglicherweise mit dem Auto. Die CO2-Ersparnis ist natürlich auch dann dahin, wenn potenzielle Käufer sich erst im Laden beraten lassen, um das gleiche Produkt anschließend online – und billiger – zu shoppen. Auch eine Zustellung innerhalb eines Zeitfensters ist nicht unproblematisch. Denn diese Option ist zwar bequem für den Besteller – hat aber zur Folge, dass Liefertouren anders geplant werden müssen und Wagen nicht voll beladen fahren.
Auch die Paketgröße hat Einfluss auf die Umweltbilanz. Oft werden nämlich Artikel (mit entsprechend viel Füllmaterial aus Plastik oder Papier) in viel zu großen Kartons verpackt. Das kostet wertvollen Platz in den Lieferautos – und verursacht entsprechend mehr CO2-Emissionen.
Dass Läden und Geschäfte unter der wachsenden Konkurrenz des Online-Handels leiden, Innenstädte und Einkaufsmeilen veröden, dass vor allem niedrigpreisige Retouren teilweise vernichtet werden und Paketfahrer oft unter schlechten Bedingungen arbeiten, ist da noch gar nicht eingerechnet. Zudem müsste für eine umfassende Bilanzierung auch der CO2-Fußabdruck eines Produkts – ob online oder offline gekauft – einfließen.
Der wohl beste Tipp gilt für für jede Art von Geschaft: Stellen Sie sich die Frage, ob Sie den Artikel wirklich brauchen. Und: Ist er lange haltbar und reparierbar?