Prolog: Schüsse auf den eigenen Mann
Kaum ist Isser Beeri, ein großer Mann mit tief liegenden Augen, im Februar 1948 zum Chef des Schai ernannt worden, des Vorgängers der israelischen Geheimdienste, geschieht Verstörendes. Wanderer entdecken eine halb verbrannte Leiche voller Gewehrkugeln. Der Freund eines hohen Politikers verschwindet in einem israelischen Folterkeller, dem er erst 72 Tage später, bedeckt mit Wunden und ohne Zähne entkommt - ein gebrochener Mann für den Rest seines Lebens. Am 30. Juni wird ein Hauptmann der israelischen Armee verhaftet und vor ein Schnellgericht gestellt, das ihn ohne Verteidigung in wenigen Minuten verurteilt und erschießen lässt. Eine Untersuchung ergibt: Alle drei Verbrechen hat Isser Beeri befohlen, der asketische, verschlossene Chef-Spion, bekannt für seine patriotische Hingabe. Premierminister David Ben Gurion zürnt voll Abscheu: Einen solchen Geheimdienst, der über allem Recht steht, will er nicht dulden. Beeri wird seines Amtes enthoben, aus der Armee entlassen und für einen Tag ins Gefängnis gesperrt.
Ben Gurions Entscheidung bestimmt fortan das Selbstverständnis der israelischen Geheimdienste: Keine Unterdrückungsapparate sollen sie sein und sich nie gegen das eigene Volk wenden. Dafür haben sie zu viele Kriege zu führen - wie sich bald herausstellen soll: fünf Kriege. Gegen die arabischen Nachbarn, gegen die Palästinenser, gegen flüchtige Nationalsozialisten, für die Rettung von Juden überall auf der Welt und für die Beschaffung von überlebenswichtigem Know-how. Aber die Fragen, die Isser Beeri aufwirft, quälen Israels Geheimagenten seither: Wie böse muss der Gute sein, um das Gute zu schützen? Wie viele Gesetze dürfen sie brechen, um die Demokratie zu verteidigen? Wie viele Schmerzen zufügen, um größere zu verhindern? Ein späterer Chef des Mossad (der für Auslandseinsätze zuständigen Organisation unter den drei israelischen Nachrichtendiensten) wird erklären: "Die schmutzigsten Aktionen müssen die ehrenhaftesten Männer ausführen." Ohne sich dabei zu beschmutzen?
Der Mossad ist heute eine Behörde mit rund 3000 Angestellten - weniger als die Stadtverwaltung von Wuppertal. Das Hauptquartier des "Instituts für Aufklärung und besondere Aufgaben", so der offizielle Name, liegt im Norden von Tel Aviv, gegenüber einem Country Club, in Sichtweite gleißt das Mittelmeer. Besichtigungen sind nicht möglich. Hier wird Israels wohl erfolgreichstes, in jedem Fall bekanntestes Produkt hergestellt, ein Amalgam aus Angst und Bewunderung, aus höchster Raffinesse und äußerster Brutalität – so jedenfalls dürften es Außenstehende wahrnehmen. Sie nennen es den "Mythos Mossad". Die Angestellten, die mehrheitlich geregelte Bürozeiten haben, würden ihr Produkt mit einem anderen Wort beschreiben: Sicherheit. Schutz für ein bedrohtes Land. Und vielleicht ist der Mossad auch deshalb Israels imposanteste Marke: weil er so viel größer scheint, als er tatsächlich ist. Und damit ein bisschen so wirkt wie Israel selbst. Weil seine Feinde ihn überall vermuten. Dabei zählt er nicht einmal ein Hundertstel der Mannstärke der CIA, und zu sowjetischen Zeiten war er 200-mal kleiner als der KGB. Ein Zwerg unter Riesen. Schweigen nährt die Größe. Der Mossad hat keine seiner Aktionen je kommentiert, weder bestätigt noch dementiert, außerdem unterbindet die israelische Zensur viele Enthüllungen.
Das verstärkt die Wucht des kleinen Apparats: Niemand soll ihn ausrechnen. Einige Operationen aber sind bekannt geworden, weil Beteiligte später geredet, Journalisten recherchiert oder Untersuchungskommissionen geprüft haben. Nur aus diesen Aktionen lässt sich das Wesen des Mossad entschlüsseln. Aber sie sind auch eine Falle: Noch die Misserfolge bekräftigen den Mythos, da sie nahelegen, dass der Mossad sich an Hasardstücken versucht, die andere nicht einmal erwägen würden.
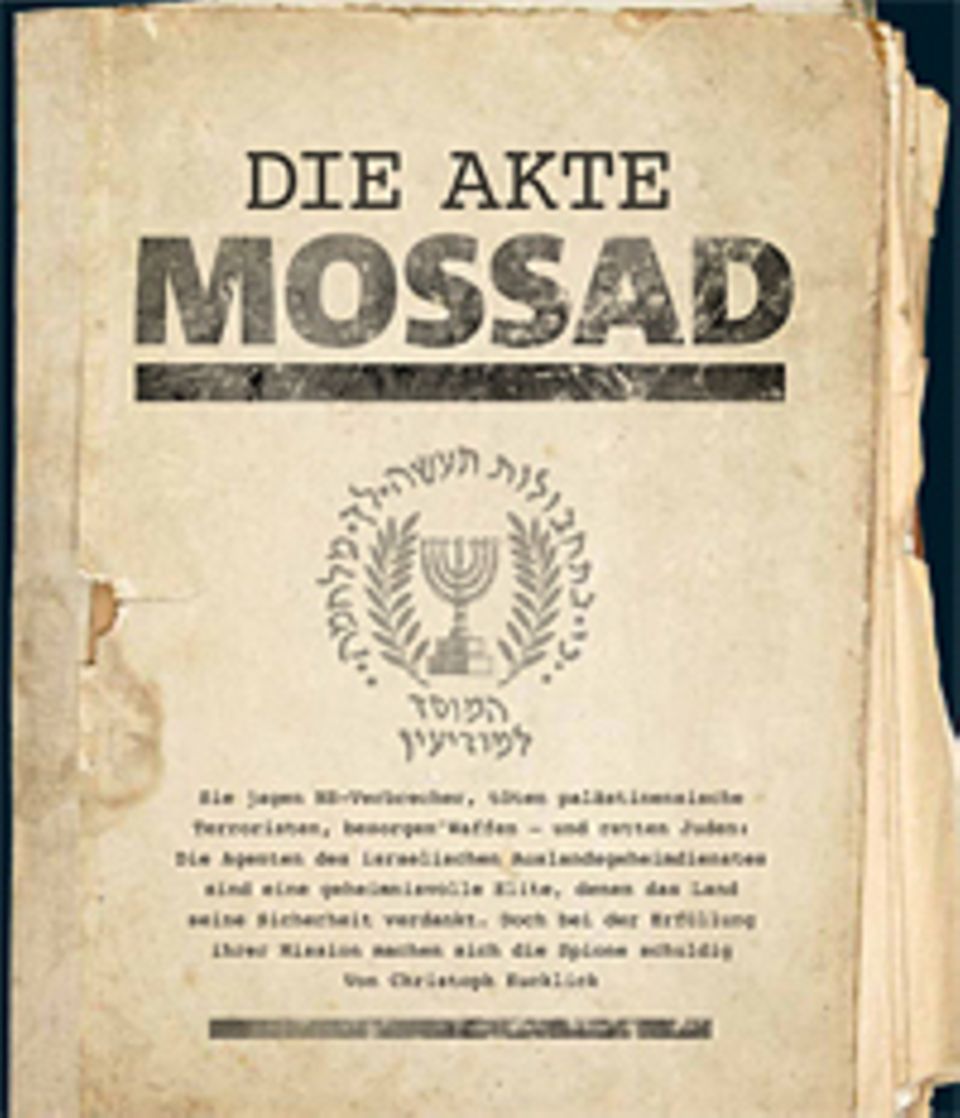
Der Krieg gegen die arabischen Nachbarn
Elie Cohen ist das genaue Gegenbild zu Isser Beeri. Der beste Spion des Mossad, der Stolz Israels. Aber die Nation erfährt von ihm erst, als er, ein beständiges Zucken im Gesicht von den Elektroschocks seiner Folterer, in Damaskus vor Gericht steht. Bis dahin kennen kaum eine Handvoll Menschen seinen wahren Auftrag. Der Sohn ägyptischer Juden ist gerade aus Kairo nach Israel eingewandert, als er 1960 im hohen Alter von 36 Jahren angeworben wird. Seine Ausbildung ist gründlich und umfasst vieles, was auch heute noch gelehrt wird: sichere Häuser einrichten, unsichtbare Tinte benutzen, Botschaften verschlüsseln. In jedem Spionageroman finden sich die Details, aber sie zu beherrschen, das erfordert jahrelanges Training. Denn vor allem müssen die Rekruten lernen, die menschliche Seele neu zu sehen: als verletzliche, als täuschbare. Um Agenten anzuwerben, so erfahren sie, funktionieren nur drei Köder: Geld, Sex oder starke Gefühle - wie Enttäuschung über eine ausgebliebene Beförderung. Aus Sicht von Spionen ist der Mensch ein simples Wesen.

Aber Mossad-Agenten werden härter gefordert als die anderer Dienste. Sie werden noch während der Ausbildung zum Schein entführt und brutalen Verhören unterzogen, sie müssen sich ständigen psychologischen Tests stellen und alle drei Monate dem Lügendetektor. Cohen indes, der in Ägypten für den jüdischen Untergrund gearbeitet hatte, absolviert seine Ausbildung in sechs Monaten, und auch seine neue Biografie muss er im Schnellverfahren aufbauen. Um ins Herz des Feindes zu gelangen, wird er ans andere Ende der Welt geschickt, nach Buenos Aires. Dort kommt er 1961 unter dem Namen Kamal Amin Tabet an und beginnt, sich in die Gemeinde der Exil-Syrer einzuschmeicheln. Er führt das Leben eines reichen Kaufmanns, gibt Partys, spendet großzügig und wird bald auf die Feste der wohlhabendsten Syrer eingeladen und schließlich auch in die Botschaft. Nur mit Frauen sieht man Tabet nie allein, denn er bleibt seiner Ehefrau Nadia treu, die in Tel Aviv gerade ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat, Sophie. Dann sammelt Tabet Empfehlungsschreiben seiner neuen Freunde ein, um nach Damaskus zu ziehen. Aber es dauert Monate, bis er dort ankommt, denn in der Zwischenzeit verfeinert er in Israel seine Kenntnisse: Er lernt, zwölf bis 16 Worte pro Minute zu verschlüsseln und mit einem winzigen Radiosender zu übertragen, er liest alles über Syrien. Geheimdienstexperten weisen ihn in Politik und Militär des Landes ein.
Im Januar 1962 fährt Tabet vom Libanon nach Damaskus, im Koffer einen winzigen Sender, Verschlüsselungscodes in unsichtbarer Tinte, Dynamitstangen, versteckt in Seifen und Zigarren, außerdem einige Zyankalikapseln. Tabet bezieht ein prächtiges Apartment gleich neben dem Hauptquartier der Armee, und die Empfehlungsschreiben öffnen die Türen der feinen Gesellschaft von Damaskus. Spione versuchen gewöhnlich so unauffällig wie möglich zu sein - Cohen bemüht sich um das Gegenteil. Wieder ebnen großzügige Spenden, diesmal für eine Armenküche, den Weg. Bald lernt er Regierungsmitglieder kennen, die den kultivierten Millionär als erbitterten Judenhasser schätzen lernen, der sie zu immer weiterer Aufrüstung gegen Israel anstachelt - und aufmerksam zuhört, wenn die Generäle von den neuesten Waffensystemen und Grenzanlagen erzählen. Die Erkenntnisse sendet Cohen unverzüglich über die Grenze. Bedenken, dass dies auffallen könnte, hat er nicht: Im Funkgewitter der benachbarten Armeezentrale gehen seine Signale unter.
Dreimal und meist monatelang besucht Cohen seine Frau und die Kinder - das dritte wird während seines letzten Besuchs geboren - in Tel Aviv, beim letzten Mal ist er verschlossen und nervös: "Ich werde kündigen, ich lasse meine Familie nicht mehr allein." Und dann fährt er wieder zurück, der einsamste Spion der Welt. Er weiß nicht einmal, ob ein einziger weiterer Israeli in Damaskus operiert.
Einmal wird er von einem Bekannten während einer Übertragung überrascht, den Sender kann er gerade noch verbergen, aber einige Papiere mit dem Verschlüsselungscode bleiben sichtbar liegen. Was ist das, fragt der Gast. Ach, antwortet Tabet, "nur Kreuzworträtsel". Seine Chuzpe beschert immer größere Erfolge. 1963 wird ein guter Freund aus argentinischen Tagen, Amin al-Hafez, nach einem Putsch syrischer Präsident. Tabets Freunde rücken in die Regierung auf, er selbst wird angeblich als künftiger stellvertretender Verteidigungsminister gehandelt. Er nimmt an Planungstreffen der Regierungspartei teil, der Präsident schickt ihn auf diplomatische Missionen, und die Generäle zeigen ihm an der Grenze die Tunnelsysteme und Befestigungsanlagen. Israel erfährt von Kabinettsbeschlüssen, Waffenkäufen, Truppenaufstellungen. Nie wohl war ein Spion wertvoller. Zu wertvoll vielleicht. Denn als er Fehler zu machen beginnt, halten ihn seine Führungsoffiziere nicht zurück, so süchtig sind sie nach seinem Material.
Die schlimmsten Sünden eines Spions: Routine und Überheblichkeit. Cohen sendet zu oft, innerhalb von fünf Monaten im Sommer 1964 rund 100 Funksprüche, und er sendet oft zur gleichen Zeit, morgens um Punkt 8.30 Uhr. Das macht es einfach, ihn aufzuspüren. Inzwischen haben die Syrer Verdacht geschöpft, auch weil der Mossad Cohens Material an die "Stimme Israels" weitergegeben hat, den israelischen Staatssender. Und selbst der beste Spion erfährt nicht alles, nämlich dass seine immer häufigeren Übertragungen die Funksignale der benachbarten indischen Botschaft stören. Die genervten Diplomaten verständigen die Behörden. Doch erst mit hochempfindlichen sowjetischen Funkpeilgeräten gelingt es den Syrern, die Quelle der Störsignale zu orten. Sie stürmen Cohens Villa und ertappen ihn während einer Übertragung. Für das Zyankali bleibt keine Zeit.


Ein Verräter in den höchsten Kreisen: welch ein Schock für Damaskus. Wer gehört noch dazu? 69 Verdächtige werden verhaftet, mehr als 400 verhört, 17 hingerichtet. Cohen gesteht zwar, als man ihm Stromstöße durch den Körper jagt, aber Mitwisser kennt er nicht, es gibt keine. Die Syrer foltern weiter. Wie sollen sie auch seine Einsamkeit verstehen? Wie ihm abnehmen, dass er ganz allein sie so demütigen konnte?
Um ihn zu retten, bieten die Israelis mehr, als sie je zuvor oder danach geboten haben für das Leben eines Spions: über eine Million Dollar, militärische Ausrüstung, medizinisches Gerät und zehn syrische Agenten - aber Damaskus akzeptiert nicht. Zu groß die Schmach. Am 18. Mai 1965 wird Cohen öffentlich gehängt, sechs Stunden lang paradieren die Bewohner von Damaskus johlend an der Leiche vorbei.
Es ist der schmerzhafteste Verlust für den Mossad. Und der größte Triumph. Weil Cohen alles verkörperte, was der Mossad anstrebt und ihn zum Mythos gemacht hat: perfekte Planung, kühle Intelligenz, unerbittliche Nervenstärke. Gegründet wird der Mossad am 2. März 1951 als Teil einer geheimen Dreieinigkeit, die sich später nicht immer einig sein wird: Schin Bet, der Inlandsgeheimdienst; Aman, der militärische Abschirmdienst; und eben ha- Mossad le-Modiin u-le-Tafkidim Mejuchadim, das "Institut für Aufklärung und besondere Aufgaben". Der Mythos vom raffiniertesten Spionagedienst der Welt entsteht in der Ära von Elie Cohen. Der Mossad schleust damals auch Spione in die ägyptische Führung ein, etwa den Deutschen Wolfgang Lotz, die ihn mit ähnlich gutem Material wie Cohen versorgen. Geheimdienste nennen die Aufklärung durch Menschen humint (human intelligence), und sie ist eine Säule neben sigint, Abhörmaßnahmen, und osint, dem Auswerten offener Quellen wie Zeitungen und Fernsehen; auf Humint aber hat sich der israelische Geheimdienst früh konzentriert und ist darin bis heute allen anderen überlegen. Humint führt dazu, dass die Israelis als Erste jene Rede Nikita Chruschtschows in den Händen halten, in der der neue Sowjetchef 1956 hinter verschlossenen Türen mit Stalins Gräueltaten abrechnet. Der Mossad reicht das Dokument mit generöser Lässigkeit an die CIA weiter, was Israel ebenso viel Sympathie wie Bewunderung einbringt.
1966 überreden Geheimdienstler einen irakischen Piloten, mit seiner MiG- 21 nach Israel zu fliehen. So können westliche Militärs erstmals die Kampfkraft des legendären sowjetischen Fliegers testen, ein ungeheurer Coup. Kann dem Mossad etwas misslingen? Und worin besteht seine Stärke? Ist den Israelis eine besondere Geheimdienst- Kultur gelungen?
Dem MI6 sagt man nach, der letzte Überlebende des Britischen Empire zu sein: ein Snob mit Esprit und Abenteurergeist. Der KGB galt als seelenlose Maschine, aber mit bestens geschulten Agenten. Die CIA ist ein gewaltiger Konzern, berauscht von der eigenen Bedeutung und der neuesten Technologie. Und der Mossad? In ihm steckt ein wenig von allen drei Diensten, aber mehr als die anderen kann er sich auf ein ungewöhnlich kosmopolitisches Reservoir an Talenten stützen: Er rekrutiert mehrheitlich Juden in der ganzen Welt, die viele Sprachen und etliche Schattierungen der Hautfarbe bieten und damit an vielen Orten unauffällig operieren. Vor allem aber treibt eine Energie sie an, die anderen Diensten fehlt: der Wille zum Überleben. Oder die Angst vor dem Untergang. Denn der Mossad operiert im Schatten der möglichen Vernichtung Israels.
Für den Geheimdienst beginnt das Feindesland gleich hinter der israelischen Grenze. Beirut, Kairo, Damaskus: Diese gefährliche Nachbarschaft schult, und so wird der Mossad aus purer Not zum Meister der Täuschung. "Der Mossad bewegt sich da, wo sogar Engel Angst bekommen", hat ein ehemaliger Agent geschrieben - dort, wohin kaum ein anderer sich wagt.
Den vollständigen Text können Sie in der neuen Ausgabe von GEOEPOCHE "Israel" nachlesen.




























