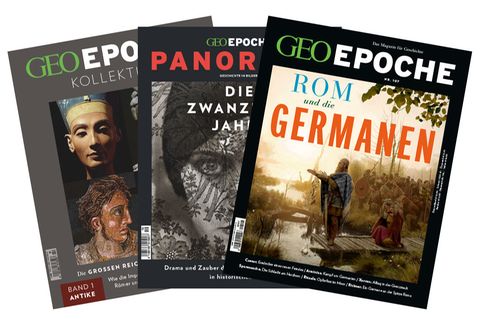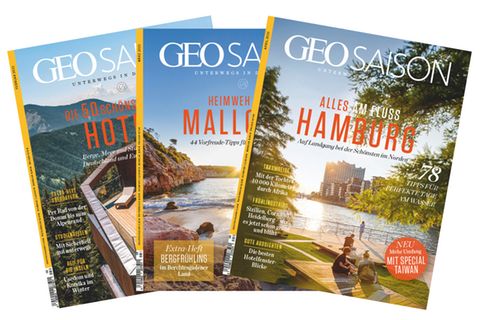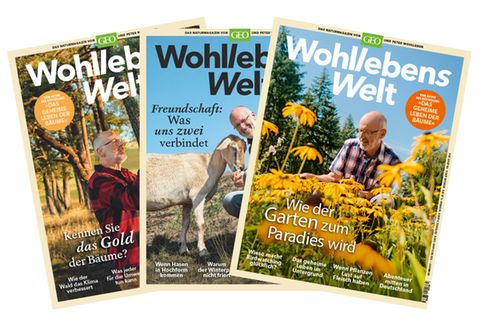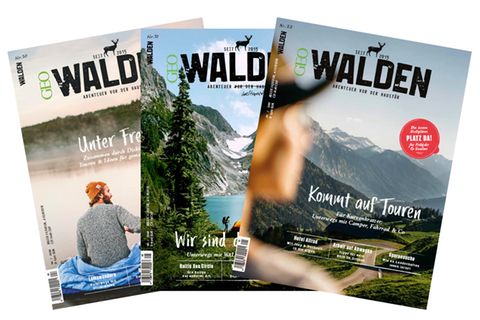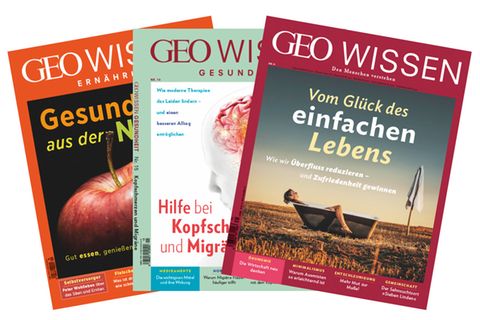Ein Freitagabend im Juli, kurz nach Sonnenuntergang in der südtürkischen Mittelmeerstadt Kaş. Aslı Corban sitzt zusammen mit Freunden in einem Restaurant, es gibt Käse und Raki, sie lachen. Seit Monaten hat sie sich auf diesen Abend gefreut, auf das tiefblaue Meer, auf die Freunde, auf diese Nacht im Lokal.
Doch irgendetwas stimmt nicht im Bild eines unbeschwerten Sommerabends.
Aslı Corban sieht, dass immer mehr Gäste im Restaurant auf ihre Smartphones starren. Etliche telefonieren, und der Ton der Gespräche wird lauter, rauer. Aslı Corban greift zu ihrem Telefon. Es ist der 15. Juli 2016, 22.28 Uhr, da schreibt sie mir, ihrem Bekannten aus Hamburg, eine Nachricht:
„Geh zu Social Media.“
Wieso, was ist los?, antworte ich.
„Irgendetwas Komisches.“
Ich sehe auf Twitter Bilder von Soldaten in der Stadt.
„Ja, F16-Jets fliegen über Ankara, die Bosporusbrücke ist gesperrt. Überall scheinen Soldaten zu sein!“
Was soll das? Putsch? Oder ein Terroranschlag?
„Es gibt Gerüchte. Ich weiß es nicht. Die sozialen Netzwerke werden bestimmt gleich gesperrt. Bleib bitte dran, informiere mich. Wir haben Angst“, schreibt Aslı.
Wo bist du?
„Wir sind in Kaş im Urlaub. Wir können auch nicht mehr auf Twitter, es ist blockiert. Was ist nur los?“
Das Militär bestätigt es: ein Putsch, schreibe ich.
„Ich habe Angst. So viele Gerüchte. Wir werden morgen aufwachen und ein anderes Land erleben.“
Ich sitze in dieser Nacht 2500 Kilometer entfernt. Auch ich verstehe nicht, was in der Türkei vor sich geht.
Ich schreibe Kadir Evler an; er lebt in Ankara. Kadir antwortet an diesem Juliabend nicht. Später erzählt er mir, er sei auf der Straße gewesen, mit Tausenden anderen. Er habe gesehen, wie Soldaten aus Helikoptern Gewehrsalven auf Zivilisten abfeuern. Blut klebte auf der Straße.
Er sagt, er habe sein Vaterland verteidigt gegen die Putschisten, und er habe gesiegt. Die Demokratie habe gesiegt, die Türkei. Nach dem Militärputschversuch feiert Kadir auf dem Kızılay-Platz, dem Hauptplatz Ankaras.
Aslı sagt, in jener Nacht habe sie den Glauben an ihre Zukunft in der Türkei verloren. Zwei Tage lang verlässt sie das Hotelzimmer nicht. Sie hat Angst.
Kadir sagt, er empfinde Glück.
Spätestens seit dem Putschversuch im Juli ist das türkische Volk tief gespalten. Auf der einen Seite die Anhänger Recep Tayyip Erdoğans, auf der anderen Seite all jene, die dem autoritären Präsidenten nicht folgen wollen. Und mittendrin jene, die Erdoğan widerwillig zur Seite stehen – nicht aus Sympathie, sondern um die Putschisten zu bekämpfen.
Diese Spaltung zeichnete sich schon seit Langem ab. Bereits im Frühsommer reisten wir, die Fotografin Charlotte Schmitz und ich, in die Türkei, um Aslı und Kadir zu treffen. Zwei Menschen, die früher beste Freunde waren und die sich über den Bruch in ihrem Land entzweit haben.
Sie sind jung, 28 und 33 Jahre alt. Sie sind Kinder der Ära Erdoğan. Sie können nicht mehr miteinander sprechen.
Dies ist ihre Geschichte, und ein wenig ist es auch die Geschichte der modernen Türkei.
Sie lesen schonungslos, was der andere denkt
Asli und Kadİr lernen sich im Herbst 2010 kennen, und es passt zu ihrer Freundschaft, dass sie sich das erste Mal in Frankreich treffen. Auf neutralem Boden.
Aslı, die Linke.
Kadir, der konservative Gläubige.
Aslı absolviert ein Auslandssemester in Bordeaux. Kadir war einige Jahre vorher dorthin gezogen; er studiert Jura. Irgendwann begegnen sie einander auf dem Campus der Universität. Sie ist mit türkischen Freunden unterwegs, er schließt sich der Gruppe an.
Kadir lädt sie in seine Wohnung ein, sie kochen zusammen, schauen Filme. In manchen Nächten, wenn Aslı in den Clubs der Stadt feiern war und den letzten Bus zum Wohnheim verpasst hat, klingelt sie bei ihm. Ihn stört es nicht, dass sie Alkohol getrunken hat. Er richtet ihr das Sofa her, sie deckt am nächsten Morgen den Frühstückstisch. Aslı sagt heute, er habe sich um sie wie ein Bruder gekümmert.
Auf Facebook schreibt Aslı im März 2011 unter ein gemeinsames Foto: „Kadir, du Licht meines Lebens.“
Später geht Kadir nach Beirut. Aslı besucht ihn. Sie mieten ein Auto und fahren durch die Stadt. Als der Muezzin zum Gebet ruft, halten sie vor einer Moschee. Aslı wartet, während Kadir betet. Als Aslı libanesischen Wein probieren will, fahren sie hinaus aufs Land und suchen ein Weingut. Kadir trinkt Wasser.
Heute sagen beide, die Toleranz habe ihre Freundschaft zusammengehalten.
Doch wo endet die Toleranz?
Aslı studiert weiter in Istanbul, Kadir zieht nach Ankara, 350 Kilometer entfernt. Sie gratulieren sich zu Geburtstagen und nehmen sich vor, einander zu besuchen. Du bist immer willkommen, sagt Kadir zu Aslı. Du hast einen Platz bei mir auf dem Sofa, sagt Aslı zu Kadir.
Ihre Freundschaft findet jetzt überwiegend auf Facebook statt. Und plötzlich federt nicht mehr das Unverfängliche des Alltags ihre Diskussionen ab, das Kochen, der Strand, die Filme. Sie lesen schonungslos, was der andere denkt.
Im Sommer 2013 ändert sich abrupt das politische Klima in der Türkei. Tausende Menschen gehen auf die Straße, um gegen den Bau einer Shopping-Mall im Istanbuler Gezi-Park zu demonstrieren. Wenige Jahre zuvor hatte Recep Tayyip Erdoğan, damals Ministerpräsident, noch angekündigt, er werde die Türkei in Richtung Europäische Union führen. Jetzt lässt er den Protest niederknüppeln.
Schon vorher beginnt er, in seinen Ansprachen das Land zu teilen. Er redet nun von „uns“ und von „denen“. Die Botschaft: Wer nicht für mich ist, ist gegen uns. Gegen die Türkei.
Facebook-Eintrag von Aslı, Juni 2013, während der Gezi-Proteste: „Ein massiver Polizeiangriff startet um 20.50 Uhr am Taksim. Sie nutzen alles, um die Menschen zu vertreiben. Es gibt keine Gegenangriffe der Demonstranten. Zelte im Gezi-Park werden zerstört. Wir sind sprachlos, und unsere Leben sind in Gefahr.“
Im Juli 2013 ändert Kadir sein Profilbild. Ein Soldat ist darauf zu sehen, er steht vor einer türkischen Flagge.
Aslı teilt Artikel über getötete Kurden.
Kadir Fotos von toten Soldaten.
Im Juni 2015 schickt Aslı Kadir eine Nachricht auf Facebook. Sie ist lang, mehrere Absätze, sie will ihren Schritt begründen, sie sagt, dass sei sie ihm schuldig.
Sie schreibt, sie könne seinen Hass auf Facebook nicht mehr ertragen. Diese Angriffe auf die prokurdische Partei
HDP. Diesen Nationalismus. Sie sagt, vielleicht seien sie doch zu verschieden. Sie schreibt, sie könne mit ihm nicht mehr befreundet sein.
Danach entfernt sie ihn aus ihrer Freundesliste. Sie löscht seine Handynummer.
Kadir antwortet ihr nie.
"Diese Menschen greifen unsere Nation an!"
Noch 22 Tage bis zum PutschVERSUCH, eine Stadt an der Mittelmeerküste. Aslı Corban sitzt bei ihrer Mutter am Esstisch. Eine kleine Wohnung im Erdgeschoss eines zehnstöckigen Wohnturms. Der Blick aus dem Fenster fällt auf weitere Apartmentsäulen. Palmen säumen die Straßen. Warme Luft drückt in das Wohnzimmer.
Aslı ist bei ihrer Mutter und ihrer Großmutter aufgewachsen. Der Vater verließ die Familie, als Aslı ein Jahr alt war. Sie hat ihn nie wiedergesehen.
Die Familie lebte damals in einer liberalen Stadt in Anatolien. Doch die Corbans fielen auf. Sie litten unter den Blicken der Nachbarn. Frauen fragten: Wie kann ein Kind aufwachsen ohne den Vater?
Aslı lernte früh, sich zu rechtfertigen. Zu diskutieren. Oft saß sie mit ihrem Onkel zusammen und sprach mit ihm über Politik. Er war aktiver Kommunist.
Heute nennt sich Aslı selbst „eine linke Intellektuelle“. Sie liest Marx, Kant, Kafka. Liebt den türkischen Schriftsteller Nâzım Hikmet und Friedrich Dürrenmatt. Seine Kurzgeschichte „Der Tunnel“ sei die perfekte Analogie zur Türkei: Ein Zug rast in einem Tunnel einem dunklen Abgrund entgegen. Die Lokomotive lässt sich nicht mehr bedienen, ebenso wenig die Notbremsen. Eine ausweglose Situation.
Aslı lief jedes Jahr beim Gay Pride Istanbul mit, einer Parade von Schwulen und Lesben. Als vor einigen Jahren auf dem Campus ihrer Heimatuniversität in Istanbul ein Starbucks eröffnet wurde, hielt sie das Café mit anderen Studenten für Wochen besetzt. Gegen Kapitalismus, gegen Ausbeutung, stand auf Plakaten.
Einmal teilte sie im Netzwerk einen Artikel über türkische Soldaten, die angeblich den Leichnam einer kurdischen Guerillakämpferin geschändet hätten. Eine Freundin schrieb: „Wie kannst du das posten? Diese Menschen greifen unsere Nation an!“
Ein anderes Mal teilte sie die Rede eines Abgeordneten. Er gedachte eines armenischen Politikers, der in den 1950er Jahren ermordet worden war. Ein Freund schrieb: „Aslı, das ist doch alles Fake, wie kannst du das glauben?“
Aslı sagt, die Polarisierung ermüde sie. Diese Spaltung. Sie merkt nicht, wie sehr sie selbst Teil davon geworden ist.
Inzwischen studiert Aslı in New York. Sie lebt bei einem Onkel, hat ein Stipendium bekommen. Und endlich Freiheit, sagt sie. Keine abschätzigen Blicke auf der Straße. Keine polemischen Diskussionen mit Kommilitonen.
An diesem Junitag, am Esstisch ihrer Mutter, frage ich sie, ob es egoistisch war, einfach zu gehen?
Aslı sagt: „Ich lasse mein Leben zurück. Meine Freunde. Aber es stimmt, ich habe nicht den Mut, in den Widerstand zu gehen. Ich will auch einfach ein nettes Leben haben.“
Wenige Tage zuvor war Aslı mit ihrer Mutter an den Strand gefahren, ein Mutter-Tochter-Tag am Meer. Noch vor Kurzem wären alle Liegen besetzt gewesen, nun blieben die meisten leer. Aslı sah darin ein Zeichen der Hoffnung: Nicht einmal die Touristen wollen etwas mit Erdoğan zu tun haben. „Das klingt zynisch, aber je schlechter es der Wirtschaft geht, umso weniger Leute unterstützen Erdoğan.“
Erst sind es die Touristen. Dann die Geschäftsleute. Am Ende bleiben ausländische Politiker fern. Die Türkei ist auf dem Weg in die Isolation.
„Önce Vatan“. Zuerst das Vaterland
Juni 2016. Noch 20 Tage bis zum Putschversuch. Die Vergangenheit der Türkei steht bei Kadir auf einem Aktenschrank. Sechs Bände, Tausende Seiten, goldgeprägter Einband, die „Große Geschichte des Osmanischen Reiches“. Daneben die „Große Geschichte des Islam“. An der Wand das Wappen des Osmanischen Reiches. Ein Schrein.
Kadir sagt, wenn er diese Bücher lese, lerne er nicht nur, was war, sondern auch, was kommen wird. Die Zukunft der Türkei.
Kadir lebt im Zentrum Ankaras, wenige Hundert Meter vom Parlament entfernt. Vor seiner Tür liegt eine Fußmatte, „Hoşgeldiniz“, herzlich willkommen. In der Wohnung fällt die Leere auf. Die Wände sind kahl, im Flur steht ein kleiner Schuhschrank. Als wäre Kadir gerade erst eingezogen. Er lebt seit drei Jahren hier.
Kadir empfängt uns in gebügeltem Hemd und Stoffhose, den Bart akkurat getrimmt. Nichts Verfängliches. Nur sein Schlüsselanhänger, eine messingfarbene Kanone, auf der steht: „Önce Vatan“. Zuerst das Vaterland. Er lässt sie in der Hand kreisen, während er redet.
Das Osmanische Reich sei ein Imperium gewesen, eine Weltmacht, sagt Kadir. Doch mit Gründung der Türkischen Republik habe Mustafa Kemal Atatürk, der erste Präsident, nicht nur die Religion aus dem Alltag verbannt, sondern auch weite Teile der alten Kultur. „Er hat unsere Vergangenheit gekappt“, sagt Kadir.
Das ist fast hundert Jahre her, aber wer verstehen will, warum viele Türken Erdoğan verehren, der muss in die Geschichte des Landes eintauchen.
Bis dahin soll einer die Türkei regieren: Erdoğan.
Nach der Gründung der Türkischen Republik im Jahr 1923 drängte Atatürk den jungen Staat Richtung Westen. Er reformierte das Land und zwang den Menschen einen neuen Lebensstil auf. Verbannte die Religion aus der Öffentlichkeit, machte den Sonntag zum Feiertag, nicht wie in der islamischen Welt üblich den Freitag. Er reformierte das osmanische Türkisch, führte das lateinische Alphabet ein und verbot Männern traditionelle Kopfbedeckungen. Von nun an sollte jeder Türke einen Hut tragen.
Wie ein Korsett zog Atatürk dem Land seine Kulturreform über, er schnürte es fester und fester. Etliche empfanden seine Reformen als Befreiung, aber andererseits fühlten sich Millionen von Türken beraubt.
Jahrzehntelang hielt dieses Korsett, und wenn ein Regierungschef wagte, es zu lockern, schritt das Militär ein. Drei Mal geschah das, 1960, 1971 und zuletzt 1980. Die Befehlshaber sahen sich damals als Verteidiger der kemalistischen Nation.
Dann kam Erdoğan.
So wie viele Russen in Wladimir Putin einen Befreier sehen, der Russland zu wahrer Größe führt, so sehen viele Türken Erdoğan. Er sei der erste Präsident, der ihnen das Gefühl gibt, sie könnten auf ihre Geschichte stolz sein, sagt Kadir.
Erdoğan verspricht seit einigen Jahren, eine Yeni Türkiye zu errichten, eine neue Türkei. So steht es seit Jahren auf den Wahlplakaten seiner „Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung“, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP). Die neue Türkei soll Erdoğans Lebenswerk werden.
Dafür muss er größer, mächtiger sein als jeder Präsident vor ihm. Auch als Atatürk. Erdoğan plant eine neue Verfassung, ein Präsidialsystem wie in den USA.
Und er verordnet der Türkei eine zweite Kulturrevolution. Langsamer als damals, aber nicht weniger umwälzend. Er verbannt Alkohol aus der Öffentlichkeit, spricht sich gegen die Gleichberechtigung von Mann und Frau aus. Und redet immer von einem Ziel: 2023. Dem Jahr, in dem die Türkei den 100. Gründungstag der Republik feiert. Bis dahin soll einer die Türkei regieren: Erdoğan.
Man kann alles, was Erdoğan tut, als einen Ausgleich für die jahrzehntelange Unterdrückung sehen. Oder als Rache. Eure Zeit ist vorbei. Jetzt kommt die unsrige.
Die Einkommen verdreifachten sich bis 2011
Kadİr wuchs in Ankara auf, seine Eltern waren gläubige Muslime. Eine Familie, die immer mit der Angst lebte, das Geld würde nicht reichen. Sein Vater arbeitete in Wäschereien, Kiosken; bis heute fährt er Schulbusse.
Die Sommer verbrachte Kadir auf einem Dorf bei Kayseri, in Zentralanatolien. Von dort stammt ein Großteil seiner Familie, Kernland der muslimisch-konservativen AKP. Bei der jüngsten Wahl stimmten 65,6 Prozent für die Regierungspartei. Als Jugendlicher, wenn das ganze Dorf auf den Feldern war, um den Weizen zu mähen und die Kichererbsen zu pflücken, brachte Kadir auf dem Rücken zweier Esel die Ernte ins Dorf. Nachts droschen die Männer den Weizen. Wir hatten nicht viel, sagt Kadir.
Als Kadir im Jahr 2001 die Schule beendete, schwächelte die türkische Wirtschaft. Die Löhne sanken, Kadirs Vater bekam jeden Monat weniger ausgezahlt. Irgendwann strich er seinen Kindern das Taschengeld.
Geh nach Frankreich, zu deinem Onkel, riet Kadirs Vater. Versuch dein Glück. Kadir packte. Zum ersten Mal verließ er die Türkei.
Er begann als Hilfsarbeiter auf Baustellen in Bordeaux, verputzte Wände in Rohbauten, pflasterte Bürgersteige. Er sortierte in einem Supermarkt die Regale ein. Nach der Arbeit besuchte Kadir eine Sprachschule, er lernte Französisch, drei Stunden lang, jeden Tag. Nach einem Jahr schrieb er sich an der Universität ein, Jura.
In der Türkei war es zu jener Zeit Frauen an Universitäten verboten, Kopftücher zu tragen. Kadir hörte von Freundinnen, die deswegen mit Perücken in die Vorlesungen gingen. Seine Mutter durfte zum Militäreid des Vaters nicht die Kaserne betreten, weil sie ein Kopftuch trug.
Universitäten und Kasernen, die alten Hochburgen der Anhänger Atatürks.
Als Kadir vor Kurzem einige Tage in seinem Dorf verbrachte, fuhr er über neu asphaltierte Straßen. Er sah auf den Feldern keine Esel, sondern Mähdrescher und Traktoren. An den Universitäten sind seit 2010 Kopftücher erlaubt.
„Seitdem Erdoğan regiert, geht es uns besser“, sagt Kadir.
In den anatolischen Städten, die als arm und rückständig galten, wuchs ein neuer Mittelstand heran, eine konservativ-
religiöse Bourgeoisie. Die Einkommen verdreifachten sich bis 2011. Das Wirtschaftswachstum stieg auf bis zu neun Prozent pro Jahr. Der Aufschwung bekam einen Titel: die Türkei, der anatolische Tiger.
Heute führt Kadir seine eigene Kanzlei. Sein Schwerpunkt: internationales Handelsrecht. Er klärt aber auch Scheidungsfälle oder einfache Delikte, Diebstahl, Körperverletzung, Betrug. Nebenbei schreibt er an seiner Doktorarbeit. Er ist ein Sohn des Erdoğan’schen Wirtschaftswunders.
Kadir kann nicht verstehen, warum junge Menschen gerade jetzt das Land verlassen wollen. Er sagt: „Wer etwas verändern will, kann durch Flucht nichts erreichen. Aber wer sich verweigert, hat einen Pass und soll gehen. Gott möge ihm den Weg ebnen.“
Als die ersten Jets über Ankara fliegen, in der Nacht des 15. Juli, sitzt Kadir auf seinem Sofa. Ihn irritiert die Uhrzeit, die niedrige Flughöhe, erinnert er sich später, als er von dieser Nacht berichtet.
Er schaltet den Fernseher ein. Er sieht Bilder von Panzern am Atatürk-Flughafen. Als ein Kampfjet nur wenige Meter über Kadirs Haus die Schallmauer durchbricht, bersten Fensterscheiben.
Um 1.30 Uhr erhält Kadir eine SMS. „Unser ganzes Volk rufen wir auf die Plätze, um den nationalen Willen und die Demokratie zu beschützen. Der Staat der Türkischen Republik.“ Jeder Bürger mit einem Handy erhält diese Botschaft von Präsident Erdoğan. Kadir zieht los.
Die Nacht hat Kadir mit seiner Kamera festgehalten. Bilder von Autos, platt gewalzt von Panzern. Von Menschen, die aus allen Richtungen auf die Hauptstraßen drängen. Menschen, die Erdoğans Aufforderung folgen.
Als Kadir am Parlament vorbeikommt, hört er eine Explosion. Wenige Schritte später fliegt ein Hubschrauber über ihn hinweg, dreht plötzlich in der Luft und schießt auf die Zivilisten. Kadir flüchtet in eine Gasse, drückt seinen Körper gegen eine Hauswand. Er bahnt sich den Weg zurück zur Hauptstraße, da kommt der nächste Helikopter auf ihn zu. Kadir rennt um sein Leben.
Hunderte Zivilisten sterben an diesem Tag. Teile des Parlaments sind zerbombt, das Büro des Premierministers ist zerstört. Die Nacht wirkt wie ein Actionfilm, so brutal, so abrupt, so schnell geschieht alles. Es ist ein Film mit einem sehr langen Nachspann.
Erdoğan wird den Putschversuch später „ein Geschenk Gottes“ nennen. Das mag zynisch klingen, aber für Erdoğan liegt eine höhere Wahrheit darin. Bei seinem beispiellosen Aufstieg fehlte nur noch eines: der Moment für die Geschichtsbücher. Das, was die wahrhaft Großen haben. Mustafa Kemal Atatürk, der Gründer der Republik. Helmut Kohl, der Kanzler der Wiedervereinigung. Nelson Mandela, der Bezwinger der Apartheid.
Lange Zeit sah es aus, als könnte der EU-Beitritt Erdoğans Moment werden. Jetzt hat er einen noch größeren: Sieger über die Putschisten, Verteidiger des Landes. Der Anbruch einer neuen Türkei.
Je härter Erdoğan zurückschlägt, umso glorreicher sein Triumph. Je mehr Feinde er ausmacht, umso höher sein Ruhm.
Und so beginnt, was Erdoğan selbst eine „Säuberungswelle“ nennt. Knapp 80 000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes werden entlassen, darunter Tausende Lehrer und Richter. Sämtliche Universitätsrektoren müssen zurücktreten. Mehr als 40 000 Menschen werden verhaftet, unter ihnen befinden sich auch Dutzende Generale und Admirale. Erdoğan ordnet an, mehr als 130 Zeitungen und andere Medienunternehmen und -anstalten zu schließen, zudem rund 4000 Firmen sowie weitere Einrichtungen.
Eine Woche nach dem Putschversuch erklärt Erdoğan den 15. Juli zum „Gedenktag für Märtyrer“. Auch die Bosporusbrücke, die Soldaten besetzt hatten und auf der sie auf Demonstranten schossen, wird umbenannt in: „Brücke der Märtyrer des 15. Juli“.
Erdoğan, der Retter, auf dem Höhepunkt seiner Macht.
„İdam istiyoruz!“, wir wollen die Todesstrafe!
Zehn Tage nach dem Putschversuch, 25. Juli. Die Straßen rund um den Kızılay-Platz, den Hauptplatz in Ankara, sind abgesperrt. Ein Montagabend, Zehntausende drängen in Richtung einer Bühne. Betonmischer blockieren die Zufahrtsstraßen, Barrikaden gegen Terroristen und Panzer. Polizisten kontrollieren jeden, der auf den Platz will.
Überall in der Masse leuchten Halbmonde und Sterne vor tiefem Rot. Auf T-Shirts und Stirnbändern, auf Fahnen und Rucksäcken, auf Schals, sogar auf Kopftüchern. „Ich sterbe für dich, meine Türkei“, singen die Menschen, unter ihnen auch Kadir. Die Menge brüllt: „İdam istiyoruz!“, wir wollen die Todesstrafe! Kadir schwenkt eine Fahne.
Vor dem Putschversuch erschien mir der junge Mann stolz, aber zurückhaltend. Antworten auf meine Fragen wägte er lange ab. Aslı war die Gesprächige, die selbstbewusst alles beim Namen nennen wollte, was in ihrem Land geschah: die Ungerechtigkeiten! Die Polizeigewalt! Eine Kämpferin. Nach dem Putschversuch sind die Verhältnisse umgekehrt. Ich schreibe Aslı. Ich will mit ihr sprechen, will wissen, wie es ihr geht.
Sie antwortet tagelang nicht. Dann schreibt sie, sie habe Angst, sie traue sich nicht mehr, sich mit mir zu treffen. Sie bittet mich, ihren wahren Namen in dieser Geschichte nicht zu nennen.
Wer gegen Erdoğan ist, hat Angst in diesen Tagen, ausnahmslos. Ein Wissenschaftler, den ich treffen möchte, will auf gar keinen Fall mit mir über Telefon, Facebook oder Skype kommunizieren. Nur persönlich. Und nur, wenn ich keinen Namen nenne, keine Universität, keine Stadt. Als ich ihn schließlich treffe, an einem sicheren Ort, sagt er: „Wir haben Angst, Beifang bei Erdoğans Säuberungswelle zu sein.“
Kadir dagegen wirkt wie ausgewechselt. Der schmächtige junge Mann tritt jetzt aggressiv auf, seine Stimme klingt bedrohlich. „4000 mutmaßliche Putschunterstützer flohen vor dem Putschversuch nach Deutschland“, raunzt er mich an. „Was macht ihr mit denen? Liefert ihr sie aus? Sicherlich nicht.“
Er redet, als wäre ich ein Feind.
„Wir können niemandem mehr vertrauen“, sagt er. „Zu viele Menschen in der Welt warten nur darauf, dass unsere Nation stirbt. Deshalb müssen wir uns verteidigen, wachsam sein!“
Wie in Deutschland nach dem Dritten Reich. Da habe man Nazis auch gehängt.
Der Adalet Sarayi, der Gerichtspalast in Ankara, strahlt wenig Prunkvolles aus. Ein Plattenbau, grau und öde. In diesen Tagen gleicht er einer Festung. Polizisten haben einen mannshohen Zaun um das Gebäude aufgestellt, Wachen kontrollieren alle Besucher an einem schmalen Durchgang, bevor sie im Foyer erneut einen Metalldetektor passieren müssen.
Kadir zeigt seinen Anwaltsausweis und geht durch die Sicherheitsschleuse. In den Gängen des Gebäudes gehen die Kontrollen weiter, an jedem Treppenaufgang: Polizisten.
In den Ecken, in orangefarbenen Shirts, kauern Soldaten, mutmaßliche Putschisten. Die meisten wirken so jung, als hätten sie gerade die Schule beendet. Später sagt Kadir, sie seien Verräter.
Er selbst vertritt als Pflichtverteidiger fünf der Soldaten. Bis zum Prozess muss er dafür sorgen, dass alles rechtmäßig abläuft. Vernehmungsprotokolle, Kontakt zu Familien, Gutachten. Beim Prozess übernehme ein anderer Anwalt. Das wolle er nicht.
Als Jurist, sagt Kadir, sei er gegen die Todesstrafe. Aber als Bürger dafür. Man müsse das Volk besänftigen, sagt er. Wie in Deutschland nach dem Dritten Reich. Da habe man Nazis auch gehängt. Das ist die Dimension, in der viele den Putschversuch sehen. Die Putschisten hätten ein Verbrechen an der Bevölkerung begangen, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Ein letztes Mal versuche ich, Aslı zu erreichen, doch sie will sich nicht mehr mit uns treffen. Sie, die vor drei Jahren am Gezi-Park protestiert hat, um Erdoğan die Stirn zu bieten, will nur noch weg, raus aus der Türkei, zurück nach New York. Sie verstummt.
Eigentlich hatten wir vor, Aslı und Kadir zu einem gemeinsamen Treffen zu überreden, von Angesicht zu Angesicht, doch das gelingt nicht.
Aslı sagt, sie wüsste nicht, was ein Treffen bringen solle. Kadir sagt, sobald sie über Politik reden, wären sie doch nie einer Meinung, sie würden streiten. Das sei sinnlos.