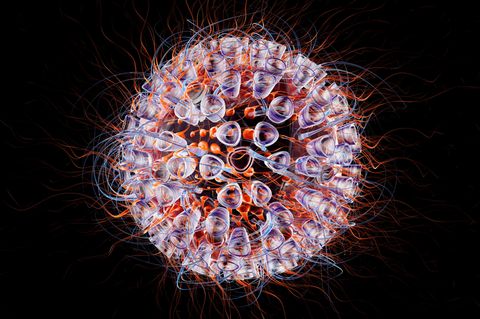Im späten 19. Jahrhunderts wurde in Paris der Leichnam einer jungen Frau aus der Seine gezogen. Wasserleichen erscheinen oft aufgequollen und entstellt. Doch dieses Mädchen, noch jugendlich, umgab eine Aura des Friedens. Ihr Körper wies keinerlei Spuren von Gewalteinwirkung auf. Ein feines Lächeln umspielte ihre Lippen, als habe sie kein grausames Ende gefunden, sondern sei sanft in einen glücklichen Traum geglitten. Der Pathologe, der sie untersuchte, war von ihrem Antlitz so fasziniert, dass er eine Totenmaske aus Gips anfertigen lies, um es zu bewahren.
Wer das Mädchen war, woher sie stammte und was ihr widerfahren war – all das blieb rätselhaft. Zwar wurden die unbekannten Toten in Paris öffentlich aufgebahrt. Doch es fand sich niemand, der sie hätte identifizieren können. In den folgenden Jahrzehnten wurde ihre Maske tausendfach kopiert, als Kunstwerk und Souvenir verkauft. Das Lächeln der "inconnue de la Seine" zierte bald Heime auf der ganzen Welt. Gerüchte über ihr Schicksal kursierten. Hatte sie, entehrt und verlassen, ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt? Oder hatte ein Liebhaber sie ermordet?
Der Schriftsteller Richard la Gallienne sponn 1899 gar einen ganzen Roman um ihr Antlitz. In "The Worshipper of the Image" verfällt der junge Dichter Anthony dem Bann der Totenmaske, die er zufällig in einem Londoner Antiquitätenladen entdeckt hat. "Silencieux", wie er sie tauft, scheint zum Leben zu erwachen, bezirzt und demütigt ihn, und fordert schließlich als Beweis seiner Liebe ein entsetzliches Opfer. Als Anthony sie bei einem ihrer Zwiegespräche nach ihren verflossenen Liebhabern fragt, antwortet sie: "Viele Lippen haben sich auf meine gepresst, Anthony, seit mich der kalte Schlaf der Seine überkam, aber keine waren so warm und wild wie deine. Ich liebte meinen Schlaf, während die anderen mich küssten, aber mit der Berührung deiner Lippen begannen sich die Träume des Lebens wieder in mir zu regen." Und siehe da: Jahrzehnte später sollten die Lippen der Unbekannten – beziehungsweise deren Nachbildung – tatsächlich zu den "meistgeküssten Lippen der Welt" werden.
Das zweite Leben der schönen Toten
Dieser zweite Teil der Geschichte beginnt mit einem österreichisch-amerikanischen Anästhesisten namens Peter Safar. Er bewies Ende der 1950er-Jahre, dass Mund-zu-Mund-Beatmung die Sauerstoffwerte im Blut bei Atemstillstand stabil hielt. Wenig später kombinierte er seine Technik mit der 1960 entwickelten Herzdruckmassage. Fortan galt die ABC-Regel: Zuerst werden die Atemwege der leblosen Person freigemacht, indem man ihren Kopf leicht nach hinten beugt und mögliche Blockaden entfernt ("Airways"). Anschließend folgen ein Check der Atmenfrequenz und, falls nötig, Mund-zu-Mund-Beatmung ("Breathing") und Kompressionen des Brustkorbs ("Circulation").
Safar wird heute als Vater der modernen Reanimation gefeiert. Den "Kuss des Lebens" hatte er unter anderem an Freiwilligen erprobt, deren Muskulatur er mit Curare, einem Gift aus südamerikanischen Lianengewächsen, gelähmt hatte. Auf diese Weise brachte er seine Probanden dem Tod so nah wie möglich. "Es war eine gefährliche Situation, wenn man nicht aufpasste", erzählte ein Freiwilliger Jahrzehnte später. "Wenn man zu viel Curare bekam, konnte man mit einem Gehirnschaden aufwachen. Aber wir hatten alle enormes Vertrauen in Peter."
Um Ersthelfer in großem Stil auszubilden, war diese Methode zweifellos ungeeignet. Der US-Kardiologe Archer Gordon und der norwegische Anästhesist Björn Lind kamen deshalb auf die Idee, eine lebensgroße Puppe zu Trainingszwecken zu entwickeln. Sie taten sich dazu mit dem Spielzeugproduzenten Åsmund Laerdal zusammen. "Das Projekt hatte eine persönliche Bedeutung für Laerdal, der 1955 seinen zweijährigen Sohn vor dem Ertrinken gerettet und das Wasser aus seiner Lunge entfernt hatte", schreiben die Medizinerinnen Stephanie Loke und Sarah McKernon im "British Medical Journal". "Gemeinsam entwickelten Lind und Laerdal eine ganze Reihe von Übungspuppen, und 1960 wurde die Familie Resusci geboren: Resusci Annie, Resusci Andy, und Resusci Baby." Annies Gesicht empfand Laerdal dabei einer Totenmaske nach, die er im Haus seiner Großeltern gesehen hatte. Die Plastikpuppe mit den geöffneten Lippen trug nun das Antlitz der unbekannten Toten aus der Seine.

Peter Safar wiederum ermutigte Laerdal, eine Feder in den Brustbereich einzubauen, sodass beim Erlernen der Herzdruckmassage einen lebensechter Widerstand zu spüren war. Die Puppe ersparte menschlichen Freiwilligen Schmerzen, Hämatome und das Risiko gebrochener Rippen. 1972 wurde sie erstmals im ganz großen Stil eingesetzt: Seattle bildete innerhalb von zwei Jahren mehr als 100.000 Menschen zu Ersthelfern aus.
Annie wird bis heute hergestellt. Ihr friedliches, leicht entrücktes Gesicht behielt sie. Und trotzdem ging sie mit der Zeit. In den 1980er-Jahren zeigte erstmals ein elektronisches Display an, wie gut sich die Übenden bei der Wiederbelebung schlugen. Seither misst die Puppe zunehmend detaillierte Daten; auch der Einsatz eines Defibrillators lässt sich an ihr erproben. Die Firma Laerdal schreibt auf ihrer Website: "Berechnungen zufolge kamen die Wiederbelebungspuppen von Laerdal bei der Ausbildung von mehr als 500 Millionen Menschen weltweit zum Einsatz." Diese Ersthelferinnen und Ersthelfer wiederum retteten schätzungsweise 2,5 Millionen Leben.
Als sei das nicht genug der Ehre, wurde Annie auch in der Popmusik verewigt. Um den Bewusstseinszustand in Not Geratener zu überprüfen, werden Ersthelfer in englischsprachigen Ländern angehalten zu fragen: "Annie, are you okay?" - Annie, geht es dir gut? Diese Zeile inspirierte Michael Jackson zu seinem Hit "Smooth Criminal". In dem Song wird Annie von einem Einbrecher niedergeschlagen. Was zu der Bluttat führte, bleibt ein Rätsel – genau wie das Schicksal der Unbekannten aus der Seine.