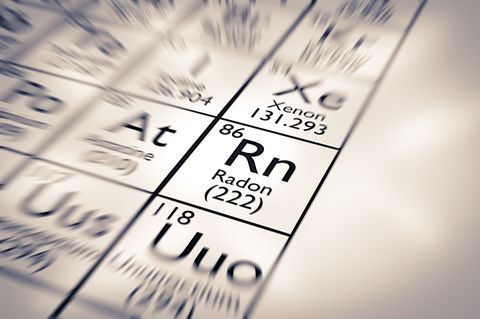Sein Lieblingsplatz ist das Sofa. Von dort aus kann er aus dem Fenster sehen. „Es ist ein schöner Moment, wenn die Sonne draußen aufgeht“, sagt der Bewohner des Neubaus im Grünen, der anonym bleiben möchte. Lange Zeit hatte er keinen solchen Blick durchs eigene Fenster, nach draußen. Der Mann lebte auf der Straße.
Doch nun wohnt er in einem weißen Apartmenthaus in Espoo, der zweitgrößten Stadt Finnlands. Das Gebäude liegt an einem See, eine Treppe führt hinunter zum Grillplatz. Dort liegt auch das Ruderboot, mit dem die Bewohner hinausfahren können zum Angeln. In dem Haus leben 35 Menschen, sie alle waren bis vor Kurzem obdachlos.
Finnland geht schon seit Jahren konsequent gegen die Not auf der Straße vor: Das Aktionsprogramm „Housing First“ vermittelt Wohnungslosen so schnell wie möglich eine Bleibe – keinen Platz in einer Massenunterkunft, sondern, wo möglich, eine eigene Wohnung.
Der Erfolg der Kampagne ist erstaunlich: Während die Obdachlosigkeit im Rest Europas zunimmt, ist die Zahl der Menschen, die in Finnland auf der Straße leben müssen, stark gesunken. Nur noch 5500 Menschen gelten dort heute als wohnungslos, davon kommen die meisten bei Verwandten und Freunden unter. Insgesamt sank die Anzahl der Langzeit-Obdachlosen um 35 Prozent. Man sieht kaum Menschen, die in Hauseingängen oder Parks schlafen.
3500 Wohnungen für das Konzept "Housing First"
Hinter „Housing First“ steckt ein einfacher Grundgedanke: Erst ein Zuhause gibt Menschen Kraft, die eigenen Probleme anzugehen – etwa nach einem Job zu suchen oder einen Drogenentzug zu wagen. Andere Länder setzen dagegen meist auf den umgekehrten Weg: Obdachlose müssen zunächst beweisen, dass sie ihr Leben tatsächlich ändern wollen, zum Beispiel indem sie Anti-Gewalt-Programme oder eine Entzugsstation besuchen. Während dieser Phase wohnen sie in temporären Einrichtungen. Erst wenn sie Erfolge nachweisen können, dürfen sie auf eine eigene Wohnung hoffen – ein Weg, der oft viele Jahre dauert. Denn in den Notunterkünften ist es meist schwer, gute Vorsätze umzusetzen: Die Mitbewohner dort haben soziale Probleme, die Kriminalität ist hoch. Viele suchen die Obdachlosenheime deshalb erst dann auf, wenn es gar nicht mehr anders geht.
Vor zwölf Jahren hat Finnland begonnen, seine großen Obdachlosenheime aufzulösen und in kleinere Einheiten mit Einzelwohnungen umzuwandeln. Außerdem wurden Apartments angekauft und zahlreiche Neubauten wie die Anlage in Espoo geschaffen.
Die Kosten für das ehrgeizige Projekt sind hoch: 250 Millionen Euro hat Finnland für neue Wohnungen und 300 zusätzliche Sozialarbeiter ausgegeben. Aber Studien zeigen, dass mit dem System auch Geld gespart wird: Die Notaufnahmen, Sozialstationen und der Justizapparat melden, dass sie mit jedem Neu-Mieter insgesamt 15000 Euro pro Jahr sparen. Mittlerweile übernehmen auch erste Städte in Deutschland das Konzept.