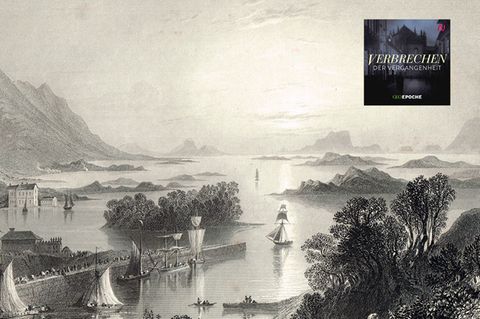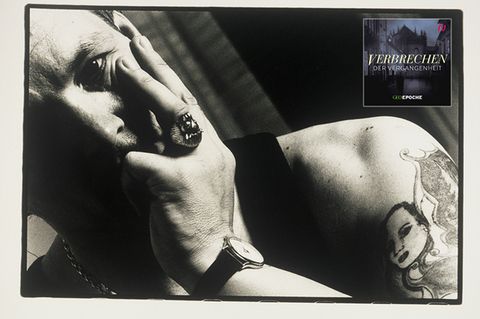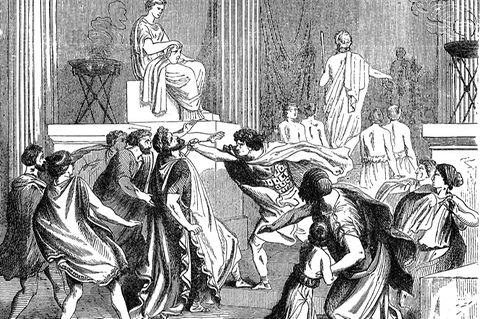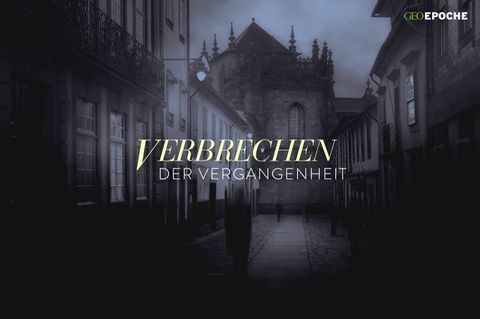GEO.de: Herr Welzer, Sie schreiben in Ihrem neuen Buch: "Es ist nicht mehr 5 vor 12." Fällt die Klimakatastrophe aus?
Harald Welzer: Nein, die fällt gewiss nicht aus. Nur stellt sich die Frage, ob eine Sackgassenrhetorik realitätsangemessen und hilfreich ist. Ich habe immer ein Problem gehabt mit dem 2-Grad- und, noch absurder, dem 1,5-Grad-Ziel. Beide wurden formuliert, obwohl es keinerlei Entwicklung auch nur in die 2-Grad-Richtung gibt. Und die Frage ist doch: Was passiert eigentlich, wenn wir das Ziel nicht erreichen? Ist Klimaschutzpolitik dann hinfällig? Ist individuelle Verhaltensänderung, ist ein anderes Kulturmodell hinfällig? Die Situation, dass Wirtschaft und Industrie weitermachen wie bisher, gleichzeitig aber dieses Menetekel der fiktionalen Gradzahlen an der Wand steht, führt zu vollkommener politischer Impotenz. Die Menschen werden notwendigerweise irgendwann feststellen: Wir schaffen das nicht. Und dann?
Als politisches Druckmittel taugt das 2-Grad-Ziel auch nicht?
Es gibt eine Notwendigkeit, die CO2-Emissionen auf null zu reduzieren. Mit diesem Argument kann man den Druck doch ganz genauso erzeugen. Und man kann auf die Extremwetterereignisse verweisen. Klimaschutzziele für 2020, 2030, das sind Wolkenkuckucksheime. Mich erinnert das an Junkies, die nächstes Jahr gerne aussteigen wollen. Das ist ein Fenster für das Nichtstun, das sich da auftut. Und was sollen die jungen Leute damit anfangen? Ich höre von Schülern oft, wir hätten doch nur noch wenige Jahre Zeit. Denen kann ich gar nicht mit Zukunftsbildern und Visionen kommen, weil die dann wieder quer laufen zu diesen postulierten fünf oder zehn Jahren, die uns noch bleiben, um die Emissionen effektiv zu reduzieren. Die Diskussion hat etwas Irreales. Wir sind politisch stillgestellt, gefangen in diesen Zahlen.
Globale Entwicklungen machen auch wenig Mut ...
Es passiert sogar das Gegenteil von dem, was notwendig wäre, wenn wir auf die Bolsonaros und Trumps schauen.
Trauen Sie Fridays for Future zu, etwas zu bewegen?
Die Schlagkraft von Fridays for Future ist enorm. Mir fällt kein Beispiel einer jungen NGO ein - und Fridays for Future sind nicht einmal formal organisiert - die einen vergleichbaren politischen Druck hat entfalten können. Weder die 68er- noch die Ökobewegung. Vor einem Vierteljahr hat die Presse einen ganzen Tag lang die Presseerklärung von Fridays for Future thematisiert, in der sie den Kohleausstieg bis 2030 fordern. Und hinterher haben die Qualitätsmedien ausgerechnet, was das kostet. Ein gigantischer Erfolg. So was hat Greenpeace nie geschafft.
Aber Fridays for Future benutzt doch genau die Fünf-vor-zwölf-Rhetorik, die Sie kritisieren?
Eines machen sie ganz anders als die Klimawissenschaftler: Sie framen das Ganze als Gerechtigkeits-Thema. Der Slogan ist: „Ihr klaut uns unsere Zukunft!“ Und genau das macht ihre Power aus. Hier sagt eine Kinder-Generation den Erwachsenen, dass sie unrealistisch sind. Alle erfolgreichen sozialen Bewegungen haben im Kern das Thema Gerechtigkeit. Und genau da sind Fridays for Future stark. Plötzlich wird in den Familien diskutiert, es wird Urlaub mit der Bahn gemacht … Da ist eine wahnsinnige Kraft in dem Ding. Die Kids sind Teil von Familien, sie sind Teil von Zukunft, es ist ihr Jahrhundert. Sie sind rhetorisch glänzend. Und sie sind angstfrei. Wenn ich in diesem Alter aus irgendeinem Grund in einer Talkshow gesessen hätte und mit einem Minister hätte sprechen müssen - ich hätte kein Wort rausgekriegt. Man kann nur staunen, wie zum Beispiel Luisa Neubauer im Spiegel-Interview Wirtschaftsminister Altmaier in die Tasche steckt. Das ist einfach großartig.
Stichwort "Zukunft": Was setzen Sie dem Lamento der Weltuntergangspropheten entgegen?
Mein Ausgangspunkt ist: Man kann nicht ungestraft die Apokalypse herbeibeten, ohne Wege aufzuzeigen, wie denn eine zukünftige Gesellschaft aussehen könnte. Das ist das große Defizit der ganzen Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsszene: Es gibt keine positiven Bilder. Es gibt nur reaktive Bilder. 'Wir müssen uns verändern, sonst ...' Wir brauchen eine Zukunftsvorstellung, damit Menschen ihr Gestaltungsmandat wahrnehmen können. Alle Generationen haben spezifische Problemlagen gehabt, es gab katastrophale Situationen in der Menschheitsgeschichte - und sie wurden bewältigt. Wir haben heute keine schlechte Ausgangslage für die Bewältigung, jedenfalls bei uns: Die Menschen sind frei, gebildet und reich. Wir haben Handlungsmöglichkeiten, es gibt eine Wissenschaft, und so weiter. Es braucht meiner Meinung nach eine Zielperspektive, einen Zukunftshorizont, um den Bann des Negativen zu überschreiten.
Mit einer Utopie?
Mit Großutopien, da hat uns das 20. Jahrhundert belehrt, kommen systematisch Mord und Totschlag. Und ich würde auch gar nicht alles abschaffen wollen. Wir sind ja schon ziemlich gut. Was die Kategorien des Kulturellen und Sozialen angeht, sind wir sogar super. Es gab noch nie eine so freie und sichere Gesellschaft. Wir haben nur das Problem, dass unsere Wirtschaft zerstörerisch ist. Wir haben ein falsches Naturverhältnis. Das war mal hilfreich, aber es funktioniert im 21. Jahrhundert nicht mehr.
Lassen sich zerstörerisches Wirtschaften und zivilisatorischer Fortschritt denn entkoppeln?
Ich habe kein Patentrezept dafür. Ich habe nur eine Vorstellung von einem Mosaik aus, wie ich es nenne, Heterotopien. Damit meine ich konkrete Utopien, Veränderungen an einzelnen Stellen, als Wegmarken für einen Pfadwechsel. Dann muss man gucken: Wie wirken die zusammen, wie verstärken sie sich, wie unterstützen sie das Gesellschaftsmodell, das ich gut finde, also das Modell der freien Gesellschaft.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Nehmen wir das 80/20-Modell, eine superkluge Idee von meinen Studis aus St. Gallen. Dahinter steckt die Erkenntnis, dass es eine enorm wichtige Ressource für den Zusammenhalt und das Funktionieren moderner Gesellschaften gibt, nämlich ehrenamtliche Tätigkeit. So etwas zu machen, ist allerdings heute nicht jedem möglich. Also, so der Vorschlag, stellen wir die Möglichkeit her, dass alle sich gleichermaßen einbringen können. Ein Fünftel der Ausbildungs- und der Arbeitszeit verwenden wir dafür, etwas für das Gemeinwesen zu tun. Diese Idee ist so bestechend, weil sie, erstens, simpel ist. Und zweitens, weil sie ein großes Problem adressiert, nämlich das Filterblasen-Problem. Die Gruppen unserer Gesellschaft sind zueinander extrem hermetisch, es gibt kaum wechselseitige Durchdringung. Diese Barriere hätten wir durch so ein Modell stark aufgelockert. Dann muss der CEO von Volkswagen eben mal im Hospiz arbeiten.
Das klingt allerdings utopisch ...
Wieso? Ich finde das nicht utopisch. Alle diese Utopien, die ich in meinem Buch beschreibe, sind realisierbar. Der utopische Horizont ist relativ nah. Unser Kulturmodell ist ein ausschließlich konsumistisches, das auf das Individuum abgestellt ist, auf dessen Verbesserung oder Anreicherung. Das 80/20-Modell dagegen hat das Soziale sozusagen schon in seiner DNA. Das ist doch cool. Das gibt doch ein ganz anderes gesellschaftliches Grundgefühl.
Sie plädieren auch für autofreie Städte. Schlagen Sie das mal in Hamburg vor ...
Auch das ist eine sehr konkrete Utopie. Das kann man umsetzen. Meine Argumentation ist immer: Wenn man die positiven Resultate solcher Veränderungen aufaddiert, dann braucht man gar nicht den Klimawandel, um sie zu begründen. Eine autofreie Stadt wäre auch dann gut, wenn es keinen Klimawandel gäbe. Denn Autos sind lebensgefährlich, verpesten die Luft und verbrauchen enorm viel Platz. Und 80/20 wäre auch dann gut, wenn es kein Artensterben gäbe. Mein Kernargument ist: Wir müssen proaktiv über die Gestaltung von Gesellschaft nachdenken. In der Regel sind ein geringerer Ressourcenverbrauch und weniger Emissionen Nebeneffekte solcher konkreten Utopien.
Unterschätzen Sie da nicht die Macht der Erzählung vom Wohlstand à la doppeltes Einkommen, Eigenheim im Grünen mit Schottergarten und SUV?
Nein, überhaupt nicht. Ich halte das für unfassbar stark. Leute halten Dinge sogar dann für gut, wenn man objektiv sagen kann: Das verschlechtert euer Leben. Menschen wie Greta Thunberg, aber auch Leute, die einfach nur versuchen, ökologisch zu leben, werden ja gehasst. Da merkt man schon, was es für eine Betriebsstörung darstellt, überhaupt etwas anderes denken zu können. Machen Sie mal jemandem seinen Schottergarten madig ...
Ganz zu schweigen von einem Verbot …
Das schon gar nicht. In diesem Land ist ja noch nicht mal ein Tempolimit durchsetzbar.
Sie schreiben in Ihrem neuen Buch, die Feststellung "Die fetten Jahre sind vorbei" könne als frohe Botschaft verstanden werden. Wie meinen Sie das?
In einer reichen Gesellschaft wie unserer ist eine weitere Steigerung von Materialverbrauch nicht wünschenswert. Weniger ist doch super! Die Leute ersticken doch in all den Dingen. Seltsamerweise haben wir, was Selbstoptimierung, Sport und so weiter angeht, ein ganz anderes Ideal, als fett zu sein. Nur, merkwürdigerweise, was Wirtschaft und Konsum anbelangt, da gilt es als toll, dass wir von allem immer mehr haben. Das ist doch ein in jeder Hinsicht dummes Modell. Jetzt, da klar wird, dass wir dieses Zivilisationsmodell nicht linear fortführen können, ist ‚Die fetten Jahre sind vorbei‘ doch eine gute Nachricht. Werden wir mal schlank!
Viele sehnen sich in einer unübersichtlicher werdenden Welt nach konkreten Tipps für das besseren Leben. Haben Sie welche?
Sie wissen schon, dass ich so was total super finde?
Ja. Also?
Tipp Nummer eins: Aufhören, über das Weltretten zu reden! Das ist eine Girlande, die immer vor irgendwelchen Handlungen aufgehängt wird. Es geht nicht darum, die Welt zu retten. Es geht darum, dass wir nicht unter unseren Möglichkeiten bleiben. Dass wir die eigene Verantwortung, die eigene Handlungsfähigkeit verstehen und ernst nehmen. Wir müssen uns auf das beziehen, was jeder kann. Der zweite Punkt: Nicht auf irgendwas warten! Nicht auf die Abschaffung des Kapitalismus, nicht auf die Befreiung des globalen Südens, die Herstellung irdischer Gerechtigkeit oder sonst was. Solange wir in einer freien Gesellschaft leben, gibt es keinen Grund, zu warten. Drittens: Sich Beispiele angucken. Vorbilder suchen, Leute, die auf eindrucksvolle Weise echt was gerissen haben. Und sich überlegen, ob man so auch sein will.