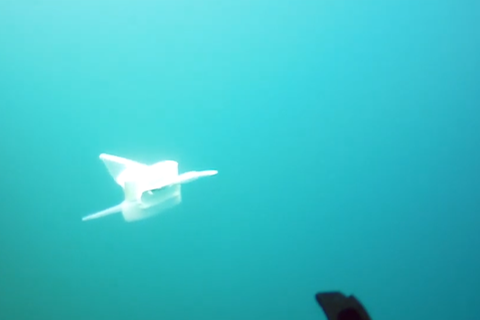Der zwölfjährige Howard Dully liegt festgeschnallt auf einem Krankenbett. Vier Elektroschocks hat ihm der Neurologe Walter Freeman versetzt. Nach dem ersten Stromstoß aber kam der Junge schnell wieder zu Bewusstsein. Der Arzt hat das Gehirn des Kindes daraufhin gleich drei weitere Male unter Spannung gesetzt – mit Erfolg: Howard fällt ins Koma.
Jetzt kann Freeman mit der Operation am Gehirn beginnen. Er greift zu seinem Spezialinstrument: einer etwa 20 Zentimeter langen, stabilen Stahlnadel mit einer scharfen Klinge an der Spitze. Mit der freien Hand hebt er ein Lid des Jungen an und schiebt das Instrument seitlich am Augapfel vorbei, immer tiefer in den Kopf hinein. Als er an die Wölbung stößt, die Augenhöhle und Gehirn voneinander trennt, nimmt Freeman ein Hämmerchen: Ein kurzer Schlag genügt, um die Stahlnadel durch die dünne Knochenschicht zu treiben.
Lobotomie soll Howard Dullys Persönlichkeit verändern
Jetzt kann Freeman sein Werkzeug direkt in das Stirnhirn des Jungen drücken, fünf Zentimeter tief. Auch durch die andere Augenhöhle führt er eine Stahlnadel ein.