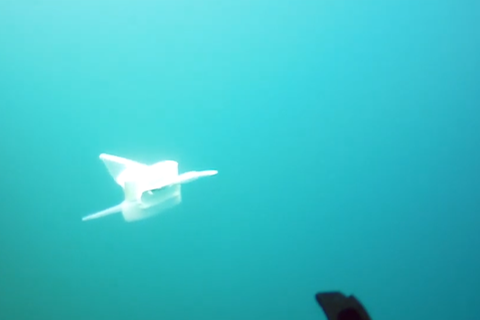Der Mensch kann auf Dauer nicht gut allein. Bereits seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte verstehen wir uns als Gemeinschaftswesen. Wie wichtig zwischenmenschliche Beziehungen für ein erfülltes und gesundes Leben sein können, bewiesen unlängst Forschungsergebnisse wie die der Grant and Glueck Studie der Havard University. Die Langzeitstudie begleitete mehr als 700 Menschen über 75 Jahre und erforschte, wie Psyche und Gesundheit miteinander verbunden sind und welche Faktoren zu einem als glücklich empfunden Leben beitragen. Zwischenmenschliche Beziehungen wurden von nahezu jedem Teilnehmer am Ende der Studie der größte Wert beigemessen.
„Humanität gilt in der Positiven Psychologie als eine von sechs Tugenden, zu denen die Charakterstärken Beziehungsfähigkeit, Freundlichkeit und soziale Kompetenz gezählt werden. Alle positiven zwischenmenschlichen Interaktionen stärken unsere Menschlichkeit, die genannten Charakterstärken und steigern unser Glücksempfinden“, erklärt Evelyn Wenzel, die sich in ihrem Beruf als Coach viel mit Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie auseinandersetzt.
Was potenzielle Helfer abhält
Das Bedürfnis sich mit anderen Menschen verbunden zu fühlen, sie in schwierigen Phasen zu unterstützen, ist also tief in unserem Wesen verankert. In der heutigen, so schnelllebigen Gesellschaft, finden wir allerdings immer seltener die Zeit, dieses Anliegen zu stillen.
„Vor mir sitzen oft Menschen in der Beratung, die hoch motiviert sind, sich ehrenamtlich zu engagieren, aber ganz offen kommunizieren, dass sie nur ein paar Stunden im Monat aufbringen können“, sagt Christiane Kalweit, Standortkoordinatorin der Stiftung Gute-Tat in Hamburg. Jene Menschen könne sie aber schnell beruhigen, denn es gäbe viele Projekte, die nicht wöchentlich Zeit verlangen würden. „Besonders die Angebote, die sich mit älteren Menschen befassen, sind gefragt − von Besuchspaten bis hin zur Betreuung von demenzkranken Menschen. Die hohe Nachfrage spiegelt natürlich auch das Altern der Gesellschaft. Im Seniorenbereich haben wir entsprechend neben der Arbeit mit Kindern und Jugendliche die größte Anzahl und Vielfalt an Projekten“, erklärt Kalweit.
Anderen mangele es nicht an Zeit oder Lust, sie quäle die Angst vor zu großer emotionaler Verpflichtung. „Viele Menschen haben keine Erfahrung im Ehrenamt, das ist auch keine Voraussetzung. Es gibt eine zentrale Frage, die ich jedem stelle, der sich bei uns informiert: Was können Sie sich vorstellen und wo sind Ihre Grenzen?“, sagt Kalweit. In den meisten Fällen ließe sich so ein geeignetes Projekt finden, mit dem sich die Freiwilligen langsam an die ehrenamtliche Tätigkeit und ihre persönlichen Grenzen herantasten könnten.
Eine weitere Gruppe, kanalisiert ihre Hilfsbereitschaft in der rein finanziellen Unterstützung von Hilfsorganisationen. Nach Erhebungen des Deutschen Spendenrats wird diese Gruppe zwar stetig kleiner, aber bewegt noch immer Milliarden – 5,3 zwischen Januar und Dezember 2018, um genau zu sein. Im Zuge der Auswertung der jährlichen Bilanz des Helfens sagte Daniela Geue, Geschäftsführerin des Deutschen Spendenrats e. V.: „Immer weniger Menschen spenden. Aber diejenigen die spenden, spenden immer mehr!“ Der größte Anteil würden an humanitäre Einrichtungen entfallen.
Gelingt das Glück auf beiden Seiten auch auf Distanz?
Dass ein finanzielles Engagement auf Distanz Verbundenheit und Wertschätzung auslösen kann, mögen Viele bezweifeln. Doch genau diese Erfahrung macht Sabine Janzen seit einigen Jahren. Die zweifache Mutter hat zwei Patenschaften bei der Kinderhilfsorganisation World Vision in Äthiopien übernommen. Zwar hat sie eins ihrer Patenkinder bereits in Afrika besucht, doch ein Großteil der Kommunikation findet über eine Entfernung von mehreren Tausend Kilometern statt. Ein weniger bestärkendes Gefühl kann Janzen bei sich dadurch nicht feststellen: „Es ist so unbeschreiblich schön, mit inzwischen mehreren Familien auf der Weltkugel so liebevoll und eng verbunden zu sein – ohne eine verwandtschaftliche Beziehung. Heute weiß ich: Entfernungen haben keinerlei Bedeutung. Sich nahe zu sein ist eine Sache des Herzens!“
Und die Hirnforschung gibt ihr Recht − in Teilen. So bestätigen einige wissenschaftliche Studien, wie die psychologische Vorfreude-Studie der kalifornischen Loma Linda University, dass gleich mehrere Glückshormone bei dem Gebenden selbst freigesetzt werden und der Anteil der Stresshormone sinkt. Tragend sind dabei Dopamin, Endorphin, Serotonin und Oxytocin. Dopamin ist besonders für das Empfinden von Vorfreude verantwortlich, Serotonin wird freigesetzt, wenn wir Anerkennung und Wertschätzung erhalten und das Bindungshormon Oxytocin, wenn wir Verbundenheit und Zusammengehörigkeit empfinden. Einige dieser Glückshormone, wie das Dopamin, entstehen also unabhängig davon, ob wir eine direkte Rückmeldung erhalten, oder nicht.
„Während ich beim aktiven Handeln unmittelbar auf unterschiedlichen Sinnesebenen eine Wirkung erlebe – ich sehe Freude, ich spüre die Umarmung, ich höre den Dank, ich rieche die Umgebung – spricht Engagement auf Distanz weniger Sinne an. Jedoch ist die Freude darüber, etwas Gutes bewirkt zu haben und die Welt durch gute Taten ein wenig besser zu machen immer noch Freude und wirkt sich positiv auf die engagierte Person aus“, führt Evelyn Wenzel aus.
„Es muss nicht immer viel sein“
Unterstützung auf Distanz ist nicht für alle Menschen, die sich engagieren möchten, eine Option. Für Mareile Fritzsche beispielsweise gehört der direkte Kontakt einfach dazu. Die Hamburger Bildredakteurin erinnert sich: „Ich hatte meine Leben lang den Wunsch anderen Menschen Wärme zu geben und ihnen in schwierigen Situationen zu helfen. Als ich dann die schockierenden Bilder aus Syrien sah und die Flüchtlingsströme, war mir klar, dass ich mich einbringen muss.“ Fritzsche nutze eine berufliche Auszeit und engagierte sich bei verschiedenen Flüchtlingsprojekten in der Hansestadt. Und dennoch kam es nur selten zu persönlichen Begegnungen mit den Menschen, für die sie eigentlich gekommen war. „Keine Frage, der Kreis der Freiwilligen war toll, aber ich hatte einfach ein Interesse an den geflüchteten Menschen, ihren Geschichten und so viel Wärme zu geben“, sagt Fritzsche. Ihr Wunsch nach mehr Nähe nahm eines Nachmittages Gestalt an, als sie im Blick einer afghanischen Frau eine sofortige Vertrautheit wahrnahm. Über die Zeit gelang es ihr trotz kultureller sowie sprachlicher Barrieren eine enge Verbindung zu der gesamten Familie aufzubauen. „Unsere Beziehung ist geprägt von mentaler und körperlicher Nähe. Besonders mit der inzwischen achtjährigen Tochter habe ich ein inniges Verhältnis. Sie ist das Kind in meinem Leben, das ich nie gesucht habe.“
Ähnlich positiv resümiert auch Christiane Kalweit ihre direkte Hilfe: „Ich habe durch die Pflege meiner Tante gesehen, wie einsam viele alte Menschen sind und wie viel Hilfe sie im Zweifel benötigen. Nach ihrem Tod wollte ich meine Zeit weiterhin ehrenamtlich einsetzen. Das hat mir sehr viel zurückgegeben. Mein Engagement hat mir gezeigt, dass man immer etwas tun kann und es muss nicht immer viel sein.