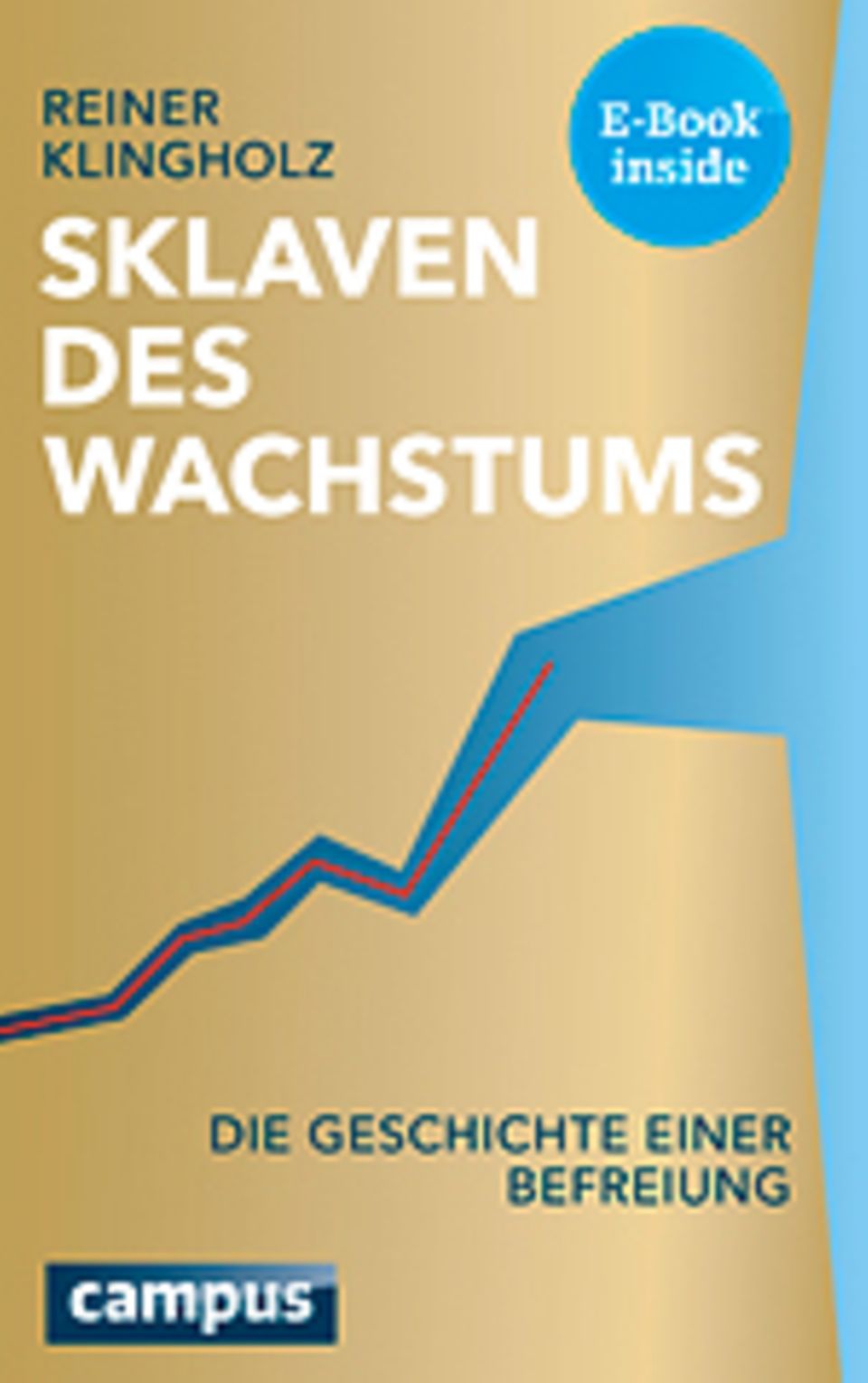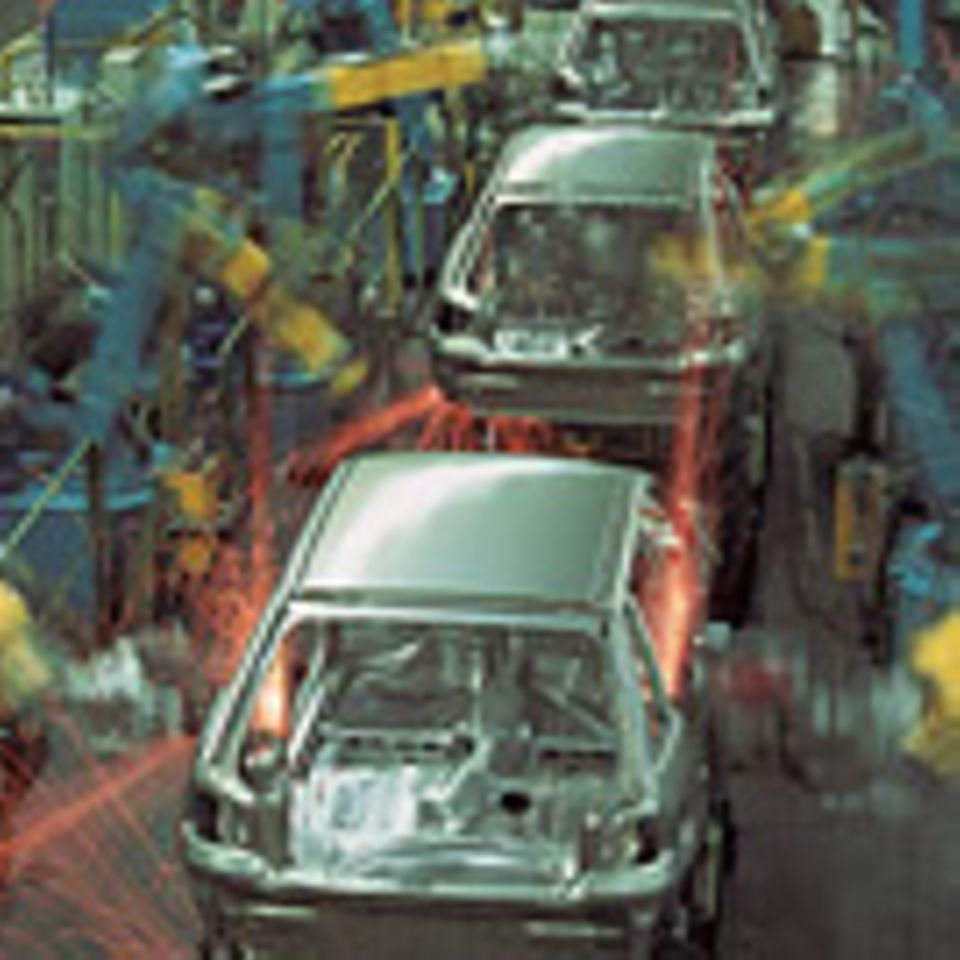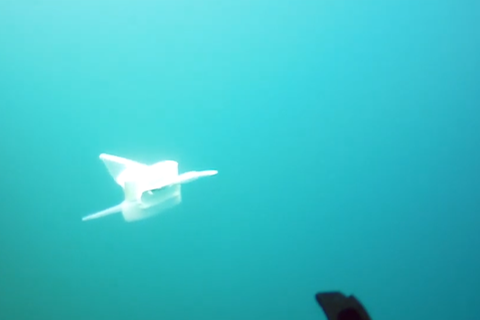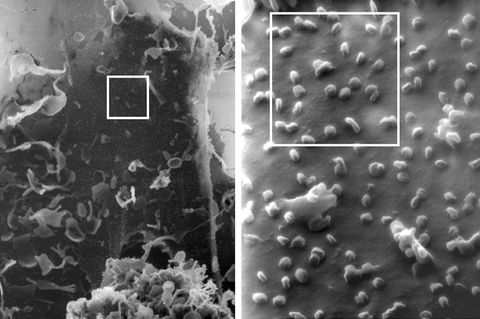GEO: Herr Klingholz, Sie prognostizieren in Ihrem neuen Buch, dass unsere Nachfahren in 300 Jahren in einem Paradies der Nachhaltigkeit leben werden. Doch vorher wird es Krisen und Konflikte um Ressourcen geben, trotz des wissenschaftlichen Fortschritts und internationalen Krisenmanagements. Wieso schafft Homo sapiens es nicht, sein zukünftiges Wohl zu sichern?
Klingholz: Dafür ist unser Gehirn nicht geschaffen. Wir verhalten uns nur in einem überschaubaren sozialen und zeitlichen Rahmen einigermaßen vernünftig. Niemand übernimmt Verantwortung für sieben Milliarden Menschen. Das könnte nur eine global abgestimmte Politik. Aber für einen Weltklimavertrag sind die nationalen Interessen viel zu unterschiedlich. Die Russen oder Saudis müssten ja sagen: Wir lassen das Öl im Boden, damit die Malediven nicht untergehen. Es gibt Probleme, für die es unter den heutigen Bedingungen keine Lösung gibt.
Es gibt immerhin Ansätze, die Wirtschaft umzubauen, hin zu einem "nachhaltigen" oder "grünen" Wachstum.
Nachhaltiges Wachstum ist eine Illusion. Nehmen wir die Energiewende. Wir könnten zwar rein technisch die Wirtschaft innerhalb von 30 Jahren komplett auf regenerative Energien umstellen. Das verlangt jedoch zunächst erhebliche Investitionen an Material und Energie - und danach säßen wir in der gleichen Falle wie zuvor, solange wir auch mit grüner Energie immer neues Wachstum produzieren müssten. Wie der Ökonom Niko Paech sagt: Das Geld, das wir mit grünem Wachstum verdienen, müssten wir zu Gartenerde kompostieren, damit es kein neues Unheil anrichtet. Wachstum, gleich welcher Farbe, bedeutet erhöhten Ressourcenverbrauch. Grünes Wachstum ist ein Widerspruch in sich.
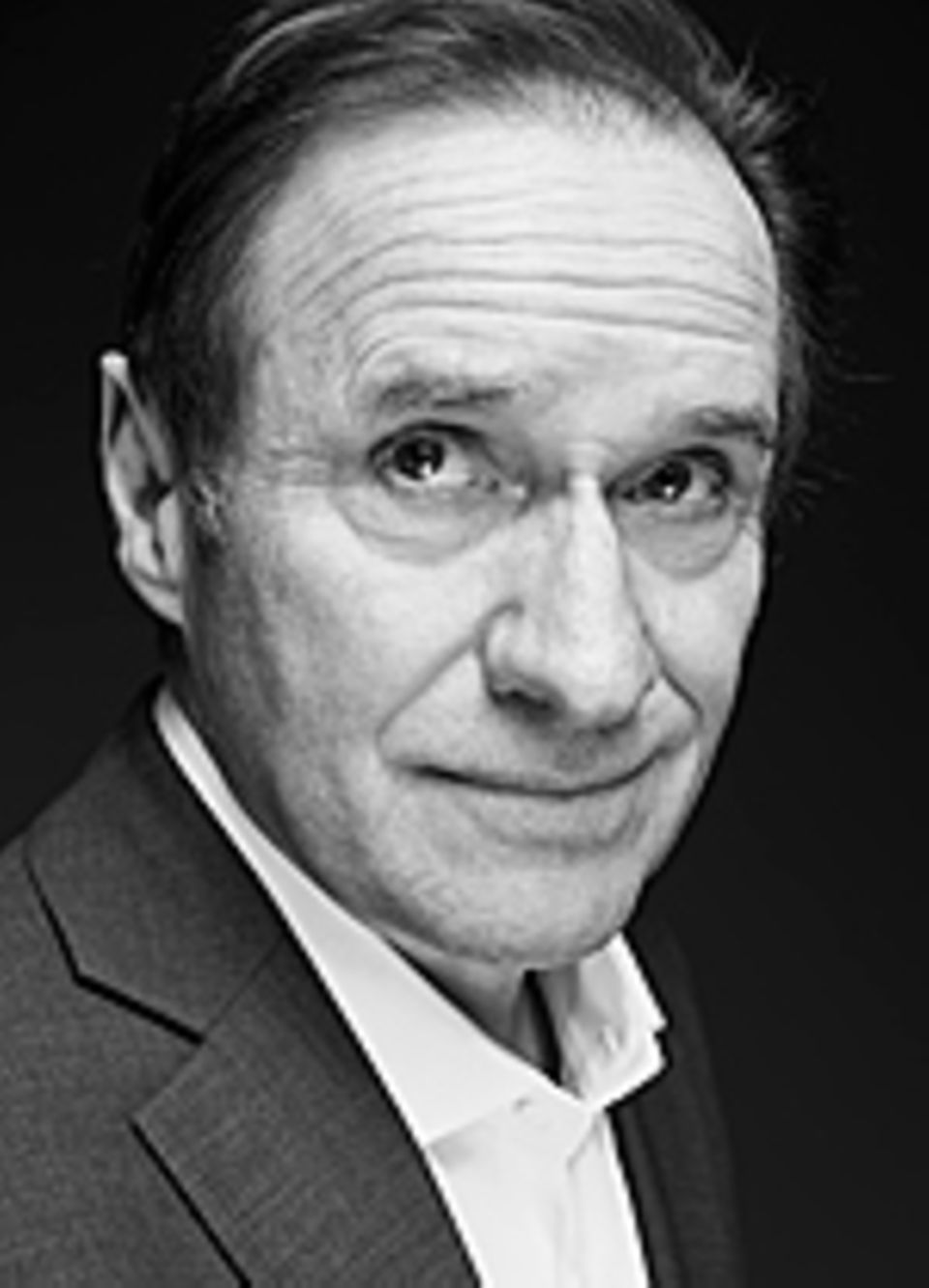

Aber so wie die armen Länder Wachstum brauchen, um sich zu entwickeln, brauchen wir es, um unsere Sozial- und Finanzsysteme aufrechtzuerhalten. Es gibt doch anscheinend überhaupt keinen Ausstieg aus dem Wachstum.
Momentan sind wir noch Sklaven des Wachstums. Aber de facto stehen wir schon mit einem Fuß im Postwachstum. Alle Industrieländer verzeichnen sinkende Wachstumsraten, selbst die boomende deutsche Wirtschaft kommt gerade mal auf ein Prozent. Diese Nationen werden künftig immer weniger junge Konsumenten haben, während die älteren das Interesse an kurzfristigen Produktzyklen verlieren. Wenn dann noch die Bevölkerung schrumpft, sinkt das Wachstum unweigerlich gegen null und tiefer. Aber statt Konzepte für ein Wohlergehen ohne Wachstum zu entwickeln, versuchen wir verzweifelt, Wachstum zu erzwingen - mit Abwrackprämien, Konjunkturprogrammen und Subventionen, zu hohen ökologischen und ökonomischen Kosten.
Wenn uns nicht die Vernunft ins Postwachstum führt, was dann?
Das Postwachstum ist eine Folge der sozioökonomischen Entwicklung. Sie hat uns Wohlstand und sinkende Kinderzahlen beschert. So weit, so gut. Aber für ein Umdenken braucht es Krisen und Katastrophen. Dann reagiert die Politik. Erst als das Waldsterben offensichtlich war, wurden Entschwefelungs- und Entstickungsanlagen Pflicht. Erst als sich das Ozonloch nicht mehr leugnen ließ, wurden Fluorchlorkohlenwasserstoffe verboten. Die wenn auch zaghafte Regulierung der Finanzmärkte wäre ohne Krise nicht entstanden, die Energiewende nicht ohne Fukushima.
Und wann sind die Krisen groß genug für ein Umsteuern?
Das ist nicht vorhersagbar. Schon kleine Ereignisse können ein politisches Umdenken auslösen. Und auch die Menschen sind in Notsituationen in der Lage und bereit, bescheidener zu leben. Aber erst in Notsituationen. Vorher kann man nicht sagen: Begnügt euch mal mit der Hälfte, auch wenn das für viele ginge.
Aber nicht nur äußerer Zwang, auch die Umweltbewegung hat doch zu einem Umdenken geführt.
Die Umweltbewegung ist gescheitert. Wovor hat sie gewarnt, welche Entwicklung wollte sie vermeiden? Ob im Kampf gegen die Überfischung, gegen Klimawandel oder Artenschwund - ihre Ziele hat sie nicht erreicht. Natürlich gibt es viele kleine Erfolge, aber keine Trendwende. Was die grüne Bewegung geschafft hat, ist, dass jetzt alles das Siegel "nachhaltig" trägt: der dickste BMW, die Olympischen Spiele, neue Finanzprodukte. Ganz böse könnte man sagen: Die Umweltbewegung hat uns ein besseres Gewissen beschert, ein Alibi, ein Placebo.
Damit verhöhnen Sie die vielen, die "bio" einkaufen, das Auto stehen lassen, ins Repair-Café gehen und heute schon Postwachstum trainieren.
Konsequent weitergedacht, müsste ich sagen: Lass uns die Katastrophe beschleunigen; ich kaufe mir, sooft es geht, ein Around-the-World-Ticket oder einen neuen SUV. Aber das wäre zynisch. Stattdessen versuche auch ich persönlich so zu leben, wie es mir mein ökologisches Denken sagt: wenig Energie verbrauchen, viel Rad fahren, Gemüse anbauen. Auch wenn ich weiß, dass ich damit nicht die Welt rette. Es fühlt sich lediglich besser an.
Lesen Sie das ganze Interview im GEO Magazin Nr. 3/2014.